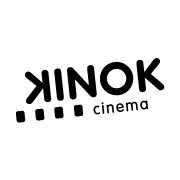St.Gallen im Film: Triste Winterstadt, seltsame Vorstellungen
von Marcel Elsener
«Gibt es eigentlich einen tollen St.Gallen-Film?» Gute Frage, immer wieder mal taucht sie auf, neulich in einer Runde mit dem in Berlin wohnhaften, aber vor allem in Europas Eisenbahnen lebenden tschechischen Schriftsteller Jaroslav Rudiš. Wir sitzen im Perronnord und reden über die Peripherie, den Jura und mögliche Filmkulissen der «Ostschweizer Metropole» – den Turm der Hauptpost im Blick, mit der grossen Uhr, die Rudiš dem Bahnhof zuschrieb und die uns an das Zifferblatt in Lars von Triers «Europa» erinnert.
Gibt es den einen St.Gallen-Film, den es Prager:innen, Wiener:innen, wenigstens Konstanzer:innen zu empfehlen gälte? Na ja, sagt einer und scrollt durch Youtube: Dies besagt einiges, der Werbefilm zur Akris-Winterkollektion 2021 von Anton Corbijn, Schaulaufen auf der Hügelkuppe und vor den wertvollsten Büchern der Welt; der niederländische Popfotograf und Regisseur («A Most Wanted Man») hielt sich in St.Gallen erwartungsgemäss an die Stiftsbibliothek und die Drei Weieren. Das pittoresk-winterliche St.Gallen und sein Weltkulturerbe sind die Trumpfkarten des Tourismusmarketings und spielen prompt die Hauptrolle, wenn internationale Filmcrews hier drehen: siehe das Liebesdrama «Meet Me in St.Gallen» der philippinischen Regisseurin Irene Villamor, das rund um den Weihnachtsmarkt entstand. «St.Gallen ist perfekt für Weihnachten», sagte sie, überwältigt von Stiftsbibliothek, Kathedrale und den Sternenlichtern über den Strassen. Die Stadt sei «gleichermassen ursprünglich und charmant».
Viel mehr als den Stiftsbezirk hat St.Gallen als «Filmstadt» nicht zu bieten, scheint es, daran arbeitete sich lehrmeisterlich schon der Doku-Spielfilm «Fortis» (2006) ab. Nicht verwunderlich, dass auch der jüngste Spielfilm mit Schauplatz St.Gallen im Klosterviertel spielt: «Friedas Fall» (2024), Maria Brendles aufwühlendes Drama um die wahre Geschichte der Frieda Keller, die ihren nach einer Vergewaltigung unehelich geborenen Bub umbringt und 1904 vom damaligen patriarchalischen Rechtssystem zum Tod verurteilt wird. Die Gallusstadt als Kulisse für Geschichtslektionen: Das ist sie selbstverständlich auch für die Spielfilme über den St.Galler Polizeihauptmann und Flüchtlingsretter Paul Grüninger («Akte Grüninger», 2014) und den Arbeitersohn Ernst S. (Schrämli), der 1942 wegen Landesverrats hingerichtet wurde («Landesverräter», 2024) – beides bedeutende Geschichten zur Schweiz im Zweiten Weltkrieg, die Richard Dindo zuvor in Dokumentarfilmen dargestellt hatte.
Historische Filmstoffe, wichtig und gut, aber was gibt das heutige St.Gallen an Filmmaterial her, inwiefern spielt es eine Rolle im aktuellen Schweizer Kino? Die Frage lässt sich anhand der Reihe erörtern, die das Kinok zum Jubiläum der 200-jährigen Sangallensien-Sammlung der Kantonsbibliothek Vadiana zusammengestellt hat. Was haben der vor eineinhalb Jahrzehnten beginnende Aufbruch und die vom Kanton verstärkte Filmförderung bewirkt? Bis dahin galt ja der ernüchternde Befund, den das St.Galler Tagblatt 2012 festhielt: «St.Gallen ist – wie die ganze Ostschweiz – nie eine Filmlandschaft gewesen, der Kanton fällt sogar im bescheidenen Schweizer Vergleich ab. Hier spielt kein ‹Höhenfeuer› und kein ‹Strähl›, kein ‹Home› oder ‹Derborance› und nicht mal ein ‹Heidi›; hier kam kein ‹Reisender Krieger› vorbei …»
Aufgezählt wurden als St.Galler Spielfilme da lediglich der Klassiker der Zürcher Praesens-Film aus dem Stickermilieu, «Das Menschlein Matthias» von Edmund Heuberger (1941) mit Aussenaufnahmen in Rorschach und im Appenzeller Vorderland, und Peter Liechtis düstere Paranoiastudie «Marthas Garten» von 1997. Dazu der Dokumentarfilm «mit denkwürdigen St.Galler Schauplätzen, der seinerzeit am meisten Aufsehen erregte»: Dindos «Die Erschiessung des Landesverräters Ernst S.» (1976) nach Meienbergs gleichnamigem Buch. Die wenigen hiesigen Regisseure – Peter Liechti und Marcel Gisler – sind ausgewandert, «der grosse Kurt Früh ist zwar in St.Gallen geboren, aber schon in Bubenjahren nach Zürich gezogen».
Der Film habe «in einer Gegend der bäuerischen Kultur einen schweren Stand» gehabt, meinte Peter Liechti damals im Tagblatt. Dass im Osten der Schweiz kaum Spielfilme entstanden seien, habe gewiss mit Geld und Infrastruktur zu tun, aber mehr noch mit «Interesse- und Fantasielosigkeit». Jedoch eröffneten günstigere Produktionsmittel, neu entstandene Lehrgänge an den Schweizer Kunsthochschulen und eine wachsende Szene von St.Galler Animations- und Dokumentarfilmschaffenden wie Michaela Müller («Miramare», 2009) oder Jan Buchholz («Eigenbrand», 2010) vielversprechende Aussichten. Und mit dem mutigen Jugendszeneporträt «ZuFallBringen» (2008) hatte Dennis Ledergerber einen Achtungserfolg erzielt.
In seiner Reihe beschränkt sich das Kinok auf Filme, die in der Stadt St.Gallen spielen. Und verzichtet demnach auf andere Werke aus dem Kanton, wie etwa die Rheintaler Filme «Rosie» (Altstätten, Marcel Gisler, 2013) oder «Das Deckelbad – Die Geschichte der Katharina Walser» (Kobelwald, Kuno Bont, 2015), letzterer eine historische Fallstudie über psychiatrische Zwangsmassnahmen in den 1930er-Jahren. Um auf die Eröffnungsfrage zurückzukommen: Ledergerbers «ZuFallBringen» und Liechtis «Marthas Garten» kommen als «tolle St.Gallen-Filme» zumindest infrage. So unterschiedlich sie sind, spielen sie beide in einer befremdlichen Winterstadt, die einen in den Wahnsinn treibt oder gar tötet. Ledergerbers Jugenddrama ist quasidokumentarisch nah an der Gasse, quirlig überspitzt, direkt und hart, mit Schauplätzen wie Splügen(eck) und US-MEX, Raiffeisen, Silberturm oder Jugendkulturraum flon.
Das Spital spielt in «Marthas Garten» eine wichtige Rolle, ebenso erscheint die Bodenseeregion als Fluchtort. Und die Lokremise kommt in beiden Filmen vor, bei Liechti freilich vor dem Umbau als triste Bahnhofsaussicht aus der Küche einer Wohnung in den (bald darauf abgebrochenen) Jugendstilgebäuden bei der St.Leonhards-Brücke. Angesichts der geputzt ausgeleuchteten St.Galler Altstadt für historische Filme erscheint Liechtis unheimlicher Schwarz-Weiss-Streifen mit seiner «somnambulen Grundstimmung» (Liechti) umso reizvoller: Er zeigt St.Gallen in «schemenhafter Distanz, anonym und austauschbar», wie der Regisseur schrieb, und macht die Stadt letztlich grösser, geheimnisvoller – zumal sich in der irrwitzigen Geschichte Anklänge an Roman Polanskis «Der Mieter» oder David Lynchs «Eraserhead» finden. Dass ihm seine ungeliebte Jugendstadt als Drehort suspekt war – «nach langen Um- und Irrwegen auf der Suche nach Motiven und Drehorten (Osteuropa, Ostberlin, La Chaux-de-Fonds) schliesslich in der Ostschweiz gelandet» – wird im Nachhinein zum Gewinn. Kalt, unwirtlich, aus der Zeit gefallen wirkt die Stadt, der Film könnte 1980 oder in den 60ern spielen. «Immer war das so, dass es Richtung St.Gallen kälter geworden ist», heisst es im Filmtagebuch zu «Hans im Glück – Drei Versuche, das Rauchen loszuwerden» (2003). «Die Zeit ist hier stehen geblieben, die Stadt hat keine Chance. Sie mag sich – Schicht um Schicht – neu einkleiden, ich riech’ noch immer den alten Mief …» Hohe Kunst der Ironie, dass Liechti später seiner filmischen Annäherung an seine Eltern, dem Versuch einer persönlichen Geschichtsrevision, den Titel «Vaters Garten – Die Liebe meiner Eltern» gab.
Die Liechti-Werke stechen in der Kinok-Reihe zum Sangallensien-Jubiläum natürlich heraus. In das Programm einzutauchen lohnt sich aber auch in den anderen Fällen: Nebst den längeren St.Galler Spiel- und Dokumentarfilmen finden sich Trouvaillen aus frühen Stadtfilmaufnahmen und jüngste Kurzfilme wie Fabienne Steiners «Café Zentrum». Das berührende Porträt des legendären Seniorencafés schliesst zufällig einen Bogen zu «Marthas Garten», weil dessen Protagonist Karl Winter (Stefan Kurt) mehrfach im benachbarten (ebenfalls eingegangenen) Café Altstadt hockt.
Von wegen authentisches Milieu und Lokalkolorit: Erstaunlich, dass aus dem kreativen Umfeld von Manuel Stahlbergers Band und sonstiger Bande (Palace, Beni Bischof, Julia Kubik u.a.) zwar wunderbare Musikvideos entstanden, aber keine Filme oder gar eine Serie à la Walliser «Tschugger». 2012 drehte der Goldacher ZHdK-Filmstudent Thomas Kuratli mit «What is love?» eine Minikrimi-Hommage an eine sagenhafte Rorschacher Beiz («Rheinfels») – mit Stahlberger-Musiker Dominik Kesseli, der eine köstliche Version des titelgebenden Welthits singt. Stimmiger, milieugetreuer geht Kurzfilm kaum, aber eben: Es blieb bei diesem Abschlussfilm, Kuratli setzte auf Musik, ging nach Paris und wurde als Elektro-Soundtüftler Pyrit bekannt.
Die Hoffnung lebt, schon dank der lebendigen Kurzfilmszene. Vielleicht kann Urs Bühler, St.Galler Drehbuchautor mit Hollywood-Hintergrund, im Gespräch nach «Verdacht» (2015) erzählen, was sich in nächster Zeit auf St.Galler Filmschauplätzen tun könnte. Sabine Boss’ Fernsehfilm über einen GBS-Lehrer unter Sex-mit-Schülerin-Verdacht, zu dem er das Drehbuch schrieb, gehört zu den Ausnahmen eines St.Galler Films mit aktuellem Stadtbild und heutiger Brisanz. Vielleicht weiss er, als mehrfacher «Tatort»-Autor, warum St.Gallen noch nie Drehort des Schweizer (derzeit Zürcher) «Tatort» war. Und warum der in Rapperswil aufgewachsene Michael Steiner nach seinem Frühwerk «Nacht der Gaukler» (1996) nie mehr im Kanton gedreht hat. Sangallensien bräuchte frischen Zuwachs in seiner Filmsammlung!
Marcel Elsener, 1964, Redaktor im Ostschweiz-Ressort des «St.Galler Tagblatt», im Kinok engagiert seit 1988, zunächst Programmgruppe, dann Vorstandsmitglied. Als zeitweiligen Filmjournalisten prägten ihn die Seminarwochen von Stephan Portmann an der Universität Fribourg. Buchpublikationen u.a. «Stadtportrait St.Gallen» (1999) und «Pfahlbauer: Nachrichten aus dem Sumpf», eine Auswahl der langjährigen Kolumne im Kulturmagazin Saiten (2024).
 Heute
Heute