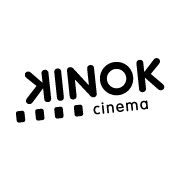Patricia Highsmith
Abgründe bürgerlicher Wohlanständigkeit
von Ulrich Kriest
«We live as we dream – alone.»
Joseph Conrad, Heart of Darkness
Im Zusammenhang mit dem Werk Hitchcocks hat der Filmwissenschaftler Thomas Elsaesser einmal festgestellt: «Nicht nur jede Generation, sondern jeder Kritiker schafft sich seinen ‹Alfred Hitchcock›, geformt aus den Momenten des Vergnügens oder des Unheimlichen, die man aus seinen Filmen zieht.» Gleiches kann man von den Romanen Patricia Highsmiths sagen, bestimmt aber von deren Verfilmungen, zumal wenn ein Stoff gleich mehrfach adaptiert wurde. Seit «Strangers on a Train» gilt: Mit Highsmith wird man einfach nicht fertig, im Gegenteil.
Als zu Beginn der Nullerjahre der Diogenes Verlag mit einer Neuedition der Bücher Highsmiths anhand von Neuübersetzungen begann, wurden schnell Mängel und erstaunliche Kürzungen der alten, immens einflussreichen Edition offenbar. Ein neuer Highsmith-Kontinent wurde sichtbar. In der FAZ konnte man seinerzeit lesen: «Erst jetzt lässt sich auch anhand der deutschen Texte begreifen, wie dicht diese Romane gewoben sind. Und Reflexionen wie die des Mörders, er habe ‹Gott verlassen und nicht Gott ihn›, fehlten früher komplett und stehen hier deshalb in neuem, rätselhaftem Glanz.» Und so liest man mit Staunen im Nachwort der Neuübersetzung von The Two Faces of January, dass Highsmith bei der Konzeption des Romans zumindest zeitweise mit der (komischen) Option einer Travestie gespielt hat. Deren dunkle Variante läse sich so: Ein unbeabsichtigter Mord in einem Athener Hotel begründet die Freundschaft zweier Männer, die sich später auf Kreta durch einen verabredeten Mord der jungen Ehefrau des älteren Mannes entledigen – und der jüngere Mann schlüpft in die Rolle der Ermordeten. Highsmith notiert: «Er übernimmt ihren Pass und ihre Garderobe – durchaus nicht ohne Vergnügen, doch mit ausreichender Unbeholfenheit, so dass es komisch wirkt. Die Stimme bereitet wenig Schwierigkeiten. Schlimmer ist der Bart.»
Als im vergangenen Jahr erstmals Highsmiths Tage- und Notizbücher publiziert wurden, sorgte die Tatsache, dass diese um offen antisemitische und rassistische Äusserungen «bereinigt» werden mussten, für Aufregung. Nicht nett, selten höflich, lesbisch, Alkoholikerin, menschenscheu bis menschenfeindlich – so das öffentliche Image zumindest der gealterten Highsmith. Mit den Tage- und Notizbüchern gibt es jetzt reichlich zu lesen von der Boheme in den 1940er- und 1950er-Jahren, von Alkoholexzessen, homosexuellen Affären, Lektüren, Kunstproduktion und Selbsterforschung, die noch einmal einen anderen, neuen Blick auf die Romane erlauben. Peter Handke, notiert Highsmith, habe ihr einmal gesagt: «‹Jedes Mal, wenn ich eines Ihrer Bücher zu lesen beginne, habe ich das Gefühl, dass Sie das Leben lieben, dass Sie leben wollen.› (Das gefällt mir!)» Denkt man hier ein «aber lange nicht konnten» hinzu, sollte man sich mit Todd Haynes’ «Carol» oder Eva Vitijas Recherche «Loving Highsmith» schlau machen, was ein Leben «in the closet» in jenen Jahren bedeutet haben mag. Was man in den Tage- und Notizbüchern aber auch lesen kann: Skizzenhaftes zu interessanten Plots wie zum Beispiel: «Ein Mann erschafft sich zu einem bestimmten Zweck einen zweiten Charakter, einen anderen Mann, dessen Leben er manchmal führt. Später gibt es guten Grund, ihn wieder zu beseitigen (…). Hinweise deuten daraufhin, dass der Mann umgebracht wurde, und unser Held sitzt in der Falle, weil der Tatort des ‹Verbrechens› mit seinen Fingerabdrücken übersät ist.»
Kein Wunder, dass Raymond Chandler einst daran scheiterte, den Plot zu «Strangers on a Train» überzeugend zu motivieren. Gehe es doch «in dieser Geschichte um den Horror einer Absurdität (…), die Wirklichkeit geworden ist». Vielleicht liegt gerade in der Annahme, sich Guy Haines als durch und durch anständig zu denken, ein groteskes Missverständnis des Romans, der ungleich radikalere, existenzialistische Töne anschlug. Man kann den flamboyanten Psychopathen Bruno Antony, der einen Austausch von Morden als perfektes Verbrechen erst vorschlägt und dann schon mal in Vorleistung geht, indem er Guys Noch-Ehefrau tötet, sehr gut als Materialisierung der dunklen Seite des «Anständigen» sehen. Womit einige Leitmotive der fiktiven Welten in «Highsmith-Country» bereits früh vorfindbar sind: Es geht um das lustvolle Beobachten und Beschreiben von Prozessen des Identitätszerfalls, von Identitätswechseln und der Befreiung von einer Identität durch einen eher spontanen als mordlustigen Akt der Gewalt. Um den Zufall als Ausgangspunkt einer Abfolge von Bewegungen. Und es geht ihr um das fortwährende, improvisierende, nicht selten absurde Spiel mit den Folgen der Gewaltakte.
Nicht grundlos ist Anthony Minghellas Neuverfilmung von «The Talented Mr. Ripley» (1999) ein Film voller Jazz! Nicht nur, dass die saturierten Hipster im Italien der 1950er-Jahre Jazzfans sind, sondern der Film geniesst es geradezu, Tom Ripley dabei zuzusehen, wie er von Situation zu Situation improvisiert und sich damit abmüht, das Heft des Handelns in die Hand zu bekommen. Homosexualität, Klassenkampf, Aufstiegssehnsüchte eines Mannes, der dazu gehören möchte – Minghella versucht die provozierenden Leerstellen der Ripley-Figur zu füllen, aber am Ende ist der Ausgangspunkt des Ganzen doch nur eine geliehene Jacke, die ein Zeichen setzt, das gelesen sein will und gelesen wird. Bei Highsmiths Figuren handelt es sich zumeist um Kippfiguren, bei denen nie ganz ausgemacht ist, wann Träume und Sehnsüchte in Alpträume und Wahn umschlagen, wann Realität gewissermassen aus Notwehr in Wahn zerstreut wird oder Träume Wirklichkeit werden. Wenn Highsmith ihre diabolischen Versuchsanordnungen exekutiert, dann schaut sie dem Treiben ihrer Figuren mit vergleichbarer Empathie zu wie Harry Lime im Wiener Riesenrad von «The Third Man» den zu kleinen Punkten gewordenen Menschen weit unter ihm.
Da ist die Hauptfigur in «Ediths Tagebuch» (1983), die einerseits vor den Zumutungen ihres Alltags und der Zeitläufte in die «Traumwelt» ihres Tagebuchs driftet, sich aber genau durch diese Drift eine spielerische Autonomie bewahrt, die man durchaus auch als Widerstand begreifen kann: «Buchstabiert ihr euer ABC alleine!», ruft sie denjenigen schweigend zu, die ihr helfen wollen. Und da ist Robert Forrester, der in «Le Cri du hibou», Claude Chabrols düsterer Highsmith-Verfilmung von 1987, hilflos und paralysiert miterleben muss, wie seine bürgerliche Existenz durch Eheprobleme und eine Scheidung, eine zufällige Begegnung und Eifersucht sich auflöst in eine Folge von Gewaltakten, bis alle ihm nahestehenden Personen tot sind. Wenn man Forrester am Schluss genau an dem Ort verlässt, dem zu Beginn seine Sehnsucht gegolten hatte, kommt einem der Satz in den Sinn, mit dem der Selbstmörder David Kelsey in Claude Millers Millers Highsmith-Adaption «Dites-lui que je l’aime» den Lauf der Dinge erschöpfend auf den Punkt gebracht hat: «Nothing was true, but the fatigue of life and the eternal disappointment.»
Hitchcocks «Strangers on a Train» machte Patricia Highsmith früh sehr berühmt. Zahlreiche Verfilmungen ihrer gefragten Geschichten folgten, doch die Beziehung zwischen Highsmith und dem Kino blieb immer problematisch. Mehr als einmal äusserte sich die Autorin enttäuscht über die Verfilmungen, die dadurch, dass sie einzelne Mosaiksteinchen innerhalb ihrer kunstvoll gewebten Konstruktionen verrückten, die ganze Statik beschädigten. Das ist schwerlich zu leugnen. Aber sagt die Tatsache, dass der Schluss von René Cléments «Plein soleil» (1960) Highsmiths Pointe vom «eindeutigen Triumph des Bösen über das Gute» geradezu einhegt, nicht mehr über die Entstehungszeit des Films aus als der Roman selbst, der seine Amoral ja affirmativ und experimentell bis an die Schmerzgrenze treibt? Der Film geht in dieser Ent-Täuschung nicht auf. Der Filmkritiker Enno Patalas erkannte in Tom Ripley einen modernen Helden, «ganz Intelligenz ohne Charakter, ein kalter Narziss» und lobte: «Der Film erklärt seinen Helden nicht, er konfrontiert den Zuschauer mit ihm und seiner Welt und zwingt ihn durch die Präzision des Bildes in die Auseinandersetzung.» Der Film zeigt aber nicht nur die bemühten und geckenhaften Anstrengungen Ripleys, sondern auch die kalte Arroganz der Macht, mit der der Playboy Dickie Greenleaf seinen Hofnarren Ripley vorführt. Unsicher wie ein geschlagener Hund lässt sich Alain Delon von Maurice Ronet schikanieren, geniesst die kurzen Momente der lebenslustigen Kumpanei und muss doch stets vorsichtig sein, sein Blatt nicht zu überreizen. Als Delon einmal in die Kleider des Freundes schlüpft und diesen «spielt», wird er von Ronet, der das Spiel etwas länger als nötig beobachtet, schroff in die Schranken gewiesen. Vielleicht hat die Figur hier plötzlich und instinktiv erkannt, welche Gefahr in den Talenten des Freund-Feindes lauert. Und sein Liebesentzug ist so zugleich sein Todesurteil.
In Highsmiths Notizen zu Strangers on a Train ist man auf die Formulierung «sex life motivates & controls all» gestossen, die ein neues Licht auf die Geschlechteridentitäten vieler ihrer Figuren werfen. Insbesondere Wim Wenders hat in seiner Highsmith-Verfilmung «Der amerikanische Freund» (1977) klar gemacht, dass die Beziehung zwischen Jonathan und Tom von kaum übersehbaren homoerotischen Gefühlen geprägt ist. Frauen fungieren als Medium und scheiden als Störfaktor von Männerfreundschaften irgendwann aus. Wenders selbst hat zu seiner Bearbeitung von Ripley’s Game angemerkt, dass ihm die Darstellung der Ehe des leukämiekranken Jonathan in der Romanvorlage zu misogyn gewesen sei, weshalb er ein paar Änderungen vorgenommen habe, die ihm Highsmith zunächst sehr übel nahm. In einem ihrer seltenen Kommentare zu den Verfilmungen ihrer Romane bemängelte Highsmith, dass die Motivation des Plots bei Wenders etwas unterbelichtet sei. Tatsächlich sind es Wenders-Figuren, die eine Gangstergeschichte nachspielen, die für Jonathan die verlockende Chance darstellt, aus seiner bürgerlichen Existenz auszubrechen – durch eine Intrige, in die ihn ein durch eine kurze Geste verletzter Tom verwickelt hat. Tom selbst ist es, der sagt, dass nun keine Freundschaft zwischen ihnen mehr möglich sei, obwohl er, der hier ein mysteriöser Einzelgänger ist, sich nichts mehr gewünscht habe.
«Jeder Mensch trägt in seinem Innersten ein schreckliches anderes Universum der Hölle und des Unbekannten mit sich herum. Er mag es nur selten zu sehen bekommen, wenn er es versucht, aber im Laufe seines Lebens erblickt er es vielleicht ein- oder zweimal (…). Aber es ist angsteinflössend und grundsätzlich verschieden von dem, wie der Mensch sich für gewöhnlich wahrnimmt, so dass wir all unsere Tage am diametral gegenüberliegenden Pol unserer selbst verbringen.» Das schreibt Patricia Highsmith am 8. Juli 1942 in ihr Tagebuch. Sie ist da 21 Jahre alt.
Ulrich Kriest ist freier Film- und Musikkritiker und lebt in der Nähe von Stuttgart.
Das Literaturhaus Wyborada St.Gallen veranstaltet am 7. April einen Highsmith-Abend. Weitere Informationen finden Sie unter www.wyborada.ch.
 Heute
Heute