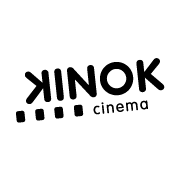Der Zirkusfilm
von Matthias Christen
Zirkus und Kino teilen eine über hundert Jahre lange gemeinsame Geschichte. Der frühe Film ist im ausgehenden 19. Jahrhundert als Projektionskunst im Umfeld jener populären Schaugeschäfte entstanden, von denen der Zirkus mit seinen Wanderunternehmen und ortsfesten Bauten lange das imposanteste und technisch fortschrittlichste war. Das erste deutsche Kinematographenprogramm, das die Brüder Max und Emil Skladanowsky 1895 im Berliner Wintergarten-Varieté vorführten, bestand aus nichts anderem als einer Reihe abgefilmter Zirkus- und Varieté-Nummern, die andernorts zeitgleich live zu sehen waren: Kraftmenschen, Akrobaten und ein boxendes Känguru. Die überbordende Fülle von Schauwerten, die der Zirkus zu bieten hat – exotische Tiere, Artistinnen und Artisten aus aller Welt, die üppigen Kostüme, das dicht gedrängte Manegenprogramm –, bleiben bis in die Gegenwart eine der Hauptattraktionen des Zirkusfilms. In Tod Brownings «Freaks» bekommt das Publikum aus nächster Nähe die Stars der Sideshow zu sehen, die bis Mitte des 20. Jahrhunderts fest zum Programmangebot amerikanischer Zirkusunternehmen gehörte: Kleinwüchsige, siamesische Zwillinge und Menschen ohne Arme und Beine, die sich Zigaretten anstecken, als wäre es die natürlichste Sache der Welt. In «Trapeze» von Carol Reed schwingen sich vor dem Auge der Kamera Akrobaten in lebensbedrohliche Höhen, und die Filmzuschauerinnen sind hoch über den Köpfen der gewöhnlichen Zirkusbesucher mit dabei.
Zirkusfilme bieten ihren Zuschauerinnen und Zuschauern all das, was sie vom richtigen Zirkus kennen – und mehr: Anfang der 1910er-Jahre entdeckt der Film den Zirkus als Schauplatz von Geschichten und eröffnet damit dem Publikum den Zugang zu einer Welt, die ihm ansonsten verschlossen bleibt. Er nimmt es mit in die Wohnwagen, Garderoben und Stallungen, dorthin, wo sich das Privatleben der Artistinnen, Clowns und Zirkusreiter abspielt. Als Teil einer Spielhandlung erscheinen die Manegenattraktionen in einem neuen Licht: Anders als das Publikum im Film, dem verborgen bleibt, was jenseits der Manege geschieht, wissen die Kinobesucher, dass die Trapezartisten, die bei ihrem Auftritt scheinbar perfekt harmonieren, in Wahrheit erbitterte Konkurrenten um die gleiche Frau sind und daher wenig Grund haben, ihr Leben vertrauensvoll in die Hand des anderen zu legen.
Die Verbindung von milieuüblichen Schauwerten mit Geschichten aus der geheimnisvollen Welt jenseits der Manege macht den Zirkusfilm in den frühen 1910er-Jahren zu einem kinematographischen Erfolgsmodell und führt zu einer eigentlichen «Zirkusfilm-Epidemie» (so Urban Gad, der mit «Afgrunden» 1910 einen der frühesten Zirkusfilme inszeniert). Gads Landsmann, der Däne Alfred Lind, dreht sechs abendfüllende Zirkusfilme, drei in Dänemark (1911/12), zwei in Italien (1915/16) und einen weiteren in der Schweiz (1918), und trägt so massgeblich dazu bei, dass sich das Genre in ganz Europa verbreitet. Um Zirkusfilme in Serie produzieren zu können, bauen deutsche und dänische Filmfirmen in den 1910er-Jahren auf ihren Studiogeländen eigene Freiluftmanegen. In den USA ist das Genre genauso beliebt: 1928 bringt Hollywood in einem einzigen Jahr vierzehn Zirkusproduktionen ins Kino, darunter Charles Chaplins «The Circus» und der heute verschollene Film «Four Devils» von Friedrich Wilhelm Murnau.
Im Zirkus wie im Zirkusfilm scheinen all die Regeln und Konventionen, die das Leben für gewöhnlich bestimmen, vorübergehend ausser Kraft gesetzt: Körper verlieren die Schwere, die ihnen sonst anhaftet, Clowns nehmen sich freimütig heraus, was im Alltag der Anstand verbietet, Raub- und Beutetiere finden ein friedliches Auskommen, und in der Freakshow verschwimmen die vermeintlich unverrückbaren Grenzen zwischen Geschlechtern und biologischen Gattungen. Mit seinen vielfältigen Grenzüberschreitungen führt der Zirkus dem Publikum sinnlich vor, dass die Welt, in der es lebt, eine ganz andere sein könnte. Der Zirkus ist insofern ein durch und durch utopischer Ort. Zugleich zwingt er die Zuschauenden nicht, in der Umwälzung der bestehenden Ordnung, welche Artisten, Clowns und Freaks vollführen, mehr zu sehen als ein sinnenfrohes Spektakel, das nach ein paar Stunden vorüber ist und nichts zurücklässt ausser Erinnerungen und luftigen Fantasien. Dass der Zirkus die revolutionären Freiheiten, die er ermöglicht, vom Publikum nicht einfordert, macht ihn als Unterhaltung aus.
Zirkusfilme dehnen mit den Geschichten, die sie erzählen, die Überschreitung etablierter Normen regelmässig auf das Leben der Figuren aus: Messerwerfer werden jenseits der Manege zu Gewaltverbrechern, Freaks verwandeln sich in Furcht einflössende Monster, und Trapezartisten überbieten sich gegenseitig als erotische Konkurrenten. Nichts spricht dafür, dass Zirkusleute leidenschaftlicher wären als ihre Mitmenschen. Genau das geben die Filme jedoch vor: Im Zirkus übersteigen die Emotionen genauso das normale Mass wie die in der Manege bewiesenen körperlichen Fertigkeiten, was die gezeigten Gefühle stark, aber potentiell lebensgefährlich macht. Damit Zirkusfilme trotzdem als Unterhaltung durchgehen, muss der Bruch von Regeln und Konventionen daher am Ende, wie im Zirkus, wieder begrenzt werden. So finden in «Trapeze» die Liebenden erst dann zum verdienten Happy End, wenn sie bereit sind, den Zirkus als Ort der überbordenden Gefühle zu verlassen.
Im Lauf des 20. Jahrhunderts hat sich der Zirkusfilm in eine Vielzahl von Untergenres aufgefächert: Es gibt ihn als Komödie, Western, Thriller, Romanze, Melodram, Krimi und selbst als Horrorfilm. Genauso wandlungsfähig sind die einzelnen Figuren aus seinem Rollenangebot: Der Clown tritt in den Zehner- und Zwanzigerjahren vorab als unglücklicher Liebhaber auf, dessen aufrichtige Gefühle die geliebte Partnerin aufgrund der komischen Rollenzuschreibung notorisch falsch versteht. In den Vierziger- und Fünfzigerjahren nimmt er dagegen öfter die Rolle des Verbrechers an, der hinter der Maske des Spassmachers ein dunkles Doppelleben verbirgt. Und ab den 1970er-Jahren wird er als düsterer, böser Clown zur Leitfigur einer Reihe von Horrorfilmen, wie zuletzt in der Neuverfilmung von Stephen Kings Roman «It» (2017).
In den meisten Zirkusfilmen bleibt der Zirkus eine exotische Gegenwelt, über die der geordnete Alltag, in den das Kino das Publikum am Ende wieder entlässt, trotz aller sinnlichen Reize den Sieg davonträgt. Es gibt allerdings eine Reihe von Filmen, in denen der Zirkus mehr ist als ein raumzeitlich begrenzter Gegenentwurf zum Alltag. Sie nutzen ihn als Modell, um über die Welt nachzudenken, die ihn – und uns – umgibt. Bei Chaplin folgt der Zirkus den gleichen brutalen Machtmechanismen, denen sich der Tramp auch «draussen» in der kapitalistischen Geschäftswelt zu entziehen versucht. Statt bloss zu unterhalten, macht Max Ophüls 1955 in «Lola Montez» am Beispiel der gleichnamigen (historischen) Tänzerin die Unterhaltung selbst zum Thema. Und Max Haufler inszeniert in «Menschen, die vorüberziehen» (CH 1942) vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs eine mehrsprachige, internationale Zirkustruppe als Idealbild einer Schweiz, die sich gegenüber den aggressiven Totalitarismen ihrer Nachbarn als offene Gesellschaft zu behaupten versucht. Gleichzeitig entstehen Mitte des 20. Jahrhunderts aber auch Zirkusfilme, die ganz andere politische und ideologische Agenden vertreten: In «Zirkus Renz» (D 1943) erobert der gleichnamige deutsche Zirkusdirektor in einer leicht durchschaubaren Allegorie auf das politische Zeitgeschehen ganz Europa. In Grigori Alexandrows «Zirk» (UdSSR 1936) überflügelt der sowjetische Artist mit seiner Nummer den deutschen Konkurrenten, und in Elia Kazans «Man on a Tightrope» (USA 1953) rettet sich ein osteuropäischer Zirkus mit knapper Not vor der kommunistischen Geheimpolizei in den freien Westen. Gleichzeitig kehrt der als Regisseur von «Jud Süss» (D 1940) politisch schwer belastete Veit Harlan 1953 just mit einem Zirkusfilm («Sterne über Colombo») in den bundesdeutschen Kinobetrieb zurück. Politisch ist der Zirkusfilm als Genre mithin genauso vielfältig und beweglich wie in den Geschichten, die er erzählt.
Mit seinen Figuren, Schauwerten und Erzählungen gibt der Zirkus insgesamt ein überaus reiches Sujet ab. Als solches ist er derart wandelbar und anpassungsfähig, dass er in letzter Konsequenz sogar sein eigenes Ende überlebt: In «I clowns», Federico Fellinis melancholischem Abgesang auf die Geschichte des Zirkus und seiner Clowns, wird zum Schluss tränenreich ein toter Clown zu Grabe getragen – nur um im nächsten Augenblick in den Studios von Cinecittà frenetisch seine Wiederauferstehung zu feiern. Auch wenn die Blütezeit der «Zirkusfilm-Epidemie» mit Dutzenden von Grossproduktionen in den 1910er- und 20er-Jahren liegt, mit über sechshundert abendfüllenden Spielfilmen aus über dreissig Ländern, ist der Zirkusfilm bis heute eines der langlebigsten, produktivsten und buntesten Genres der Filmgeschichte.
Matthias Christen aus Engelberg ist Professor für Film- und Medienwissenschaft an der Universität Bayreuth. Er ist Autor des Buchs «Der Zirkusfilm» (gefördert vom Schweizerischen Nationalfonds) sowie zahlreicher Aufsätze zu den Themen Zirkus, Zirkusfilm und Clownerie. Er arbeitet aktuell an einem Buch über Kino und Kosmopolitismus.
 Heute
Heute