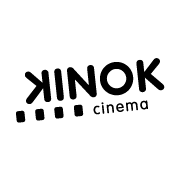Novellen aus der Welt von Gestern
Über Stefan Zweig und sein Verhältnis zum Film
Von Klemens Renoldner
Vielen Drehbüchern dienten Stefan Zweigs Erzählungen als Vorlage: Rund hundert Verfilmungen entstanden nach Texten des österreichischen Schriftstellers, der 1881 in Wien geboren wurde und sich 1942 im brasilianischen Exil, gemeinsam mit seiner Frau Lotte, das Leben nahm. Nicht nur Novellen («Angst», «Amok», «Brennendes Geheimnis», «Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau» etc.) und Romane («Ungeduld des Herzens», «Rausch der Verwandlung», «Clarissa») wurden verfilmt, sondern auch einige seiner historischen Biografien (über Marie Antoinette und Maria Stuart), ausgewählte «Sternstunden der Menschheit» und sogar einige seiner heute völlig vergessenen Theaterstücke.
Bedauerlicherweise existieren die meisten dieser Filme jedoch nur noch in Listen und Verzeichnissen, selbst in den grossen Filmarchiven Europas ist nur eine geringe Anzahl davon erhalten. Aber mit Neugier und Geschick gelingt es, so wie hier nun in St. Gallen, eine veritable Stefan-Zweig-Filmreihe zusammenzustellen.
Die enorme Renaissance des Autors, die wir seit den letzten zehn, fünfzehn Jahren in mehreren Ländern erleben, brachte einige neue Filme mit sich. Diese befördern das Interesse an dem Autor auch bei jenen, die noch nicht zu den begeisterten Zweig-Freunden zählen. Das trifft zum Beispiel auf Wes Andersons Film «The Grand Budapest Hotel» zu, der in den USA zu einem wochenlangen Zweig-Hype führte, auch in Europa mit grossem Erfolg in vielen Ländern zu sehen war und 2015 den Golden Globe für den besten Spielfilm erhielt. Wenn Anderson im Abspann des Films und in zwei begleitenden Büchern die enge Verbindung zum Werk Stefan Zweigs hervorhebt, so bezieht sich das vor allem auf das Spiel mit den Rahmenhandlungen (z.B. in «Ungeduld des Herzens») und auf die historische Atmosphäre («Die Welt von Gestern»).
Ein besonderer Glücksfall ist die jüngste deutsch-französisch-österreichisch-portugiesische Koproduktion «Vor der Morgenröte» (2016). Drehbuch und Regie stammen von der deutschen Schauspielerin Maria Schrader, Josef Hader spielt Stefan Zweig, Barbara Sukowa seine erste Ehefrau Friderike, Aenne Schwarz seine zweite Frau Lotte. Dieser grossartige Episodenfilm mit einigen Szenen aus Zweigs Exiljahren wird das Bild des Autors nachhaltig prägen, und darüber kann man sich nur freuen.
Zweig interessierte sich schon sehr früh für das Kino; aus Briefen und Tagebuchaufzeichnungen wissen wir, dass er selbst gerne ins Kino ging. Er war auch mit Schauspielerinnen und Schauspielern seiner Zeit bekannt und mit Persönlichkeiten des europäischen Theaters – Autoren, Theaterleitern, Regisseuren, Dramaturgen – eng verbunden. Er begeisterte sich also nicht nur für die Möglichkeiten der Popularisierung seiner Bücher durch Kino und Theater, sondern ihn interessierte die besondere künstlerische Umsetzung im anderen Medium. In seinem Verzeichnis aller Übersetzungen und Lizenzen, dem sogenannten «Hauptbuch», ist daher auch eine Rubrik «Film» vorhanden, in die er Anfragen und realisierte Filme sorgfältig vermerkte. Wie sehr ihm die Relation zum Kino am Herzen lag, beweist auch jenes Zitat aus einem Brief an den Komponisten Richard Strauss vom November 1931: «Ich halte eigentlich nur jene Novellen und Romane für gut, die so viele sichtliche Geschehnissubstanz haben, dass sie sich verfilmen lassen.»
Zweig selbst wirkte an verschiedenen (nicht verwirklichten) Filmprojekten mit. So verfasste er gemeinsam mit Robert Neumann ein Drehbuch nach der Oper «Manon» von Jules Massenet, er schrieb ein Treatment zu einem Film über den Panamakanal und bearbeitete – gemeinsam mit Berthold Viertel – nach seinem nicht fertiggestellten Roman «Rausch der Verwandlung» ein Drehbuch, aus dem aber erst nach dem Krieg ein Film werden sollte: 1951, neun Jahre nach Zweigs Tod, kam er unter dem Titel «Das gestohlene Jahr» in die Kinos.
Schon im Herbst 1928 traf er in Moskau mit dem Regisseur Sergej M. Eisenstein zusammen, für dessen Filme sich Zweig begeisterte. Leider kam es zu keiner Zusammenarbeit, obwohl sich Zweig dies gewünscht hätte. Später, als Zweig im Londoner Exil lebte, wurde er von der US-amerikanischen Produktionsfirma Metro-Goldwyn-Mayer eingeladen, an einer Verfilmung seiner Marie-Antoinette-Biografie mitzuarbeiten. Aber die Begegnung mit den Filmleuten in New York verlief unglücklich: Zweig spottete in Briefen über die Ahnungslosigkeit seiner Partner, und so wurde der Film ohne seine Mitarbeit realisiert. Auch ein Angebot von Max Reinhardt aus dem Jahr 1938, gemeinsam in Hollywood ein Drehbuch zu einer Verfilmung der Offenbach-Oper «Hoffmanns Erzählungen» zu schreiben, schlug Zweig aus. Als er 1939 auf einer Vortragstournee auch nach Los Angeles kam, liess er es sich nicht nehmen und besuchte Walt Disney in seinen Studios. Es war ein herzliches Zusammentreffen; Disney führte Zweig nicht nur seine Produktionshallen und einen seiner neuesten Filme vor, sondern stellte ihm auch einen Wagen mit Chauffeur zur Verfügung.
Wie sehr Zweigs Novellen aus seiner «Welt von Gestern» eine ideale Vorlage für das Kino bieten, möchte ich noch an einem Beispiel, das mir besonders gelungen erscheint, erläutern. Eine seiner besten Erzählungen heisst «Angst». Zweig war dreissig Jahre alt, als er diese Novelle niederschrieb, der Literaturbetrieb kannte seinen Namen damals noch kaum. Erst nach dem Ersten Weltkrieg, Mitte der 1920er-Jahre, erreichten seine Bücher hohe Auflagen und wurden in viele Sprachen übersetzt, was Spötter veranlasste, den Wiener Kollegen «Erwerbszweig» zu nennen.
Vier Mal wurde «Angst» bereits verfilmt und zudem mehrere Male für das Theater bearbeitet. Das hat nicht nur mit der dramatischen Zuspitzung des Konflikts und der packenden Erzählweise zu tun, sondern vor allem mit Zweigs Entscheidung, dem Leser die Möglichkeit zu geben, in das Innenleben von Irene zu sehen, ihre Gedanken zu verfolgen und ihre seelischen Nöte in allen Regungen und Nuancen mitzuerleben, so als wären es unsere eigenen. Was für ein Angebot für das Kino!
«Angst» wird zum grössten Teil aus der Perspektive von Irene, Gattin eines Rechtsanwaltes und Mutter zweier Kinder, erzählt – ein Stilmittel, das Zweig auch später mehrmals mit Erfolg verwenden wird. Irene hat keinen Beruf; sie lebt mit der Familie und leidet unter einer «breit-bürgerlichen, windstillen Existenz», unter einer «Schlaffheit der Atmosphäre». Dies mag eine Ursache dafür sein, dass sie mit einem jungen Pianisten eine Liebschaft beginnt. Eines Tages wird Irene von einer frechen Erpresserin aufgehalten: Nur mit Geld könne sie verhindern, dass ihr Ehemann von der Affäre erfährt. In ihrer Not willigt Irene ein. Aber das ist erst der Anfang, denn die Erpresserin treibt ihr Spiel energisch voran; immer wieder tritt sie Irene in den Weg, immer unverschämter werden ihre Forderungen. Aus Irenes Angst wird tiefe Verzweiflung, ihre Not steigert sich von Tag zu Tag. Schliesslich weiss sie keinen Ausweg mehr, nur noch den einen: sich zu vergiften. Als sie beim Apotheker das tödliche Pulver abholen möchte, wird ihr Arm von einer Männerhand erfasst. Es ist Irenes Mann. Und nun stellt sich heraus, dass er es war, der von Anfang an von Irenes Liebschaft mit dem Pianisten wusste, und es seine Idee war, eine arbeitslose Schauspielerin mit der Rolle der Erpresserin zu beauftragen. Das sadistische Spiel, das der sonst so korrekte Anwalt gegen seine Frau inszenierte, endet mit dem Zusammenbruch Irenes. Und der Leser mag nicht glauben, was der Ehemann sagt: «Jetzt wird alles wieder gut.»
Roberto Rossellinis grandiose Verfilmung der Novelle (Originaltitel: «La paura») stammt aus dem Jahre 1954 und ist ein Meisterwerk. Das nicht zuletzt deswegen, weil der Regisseur ein filmisches Äquivalent zu Zweigs Erzählhaltung findet: Rossellini entscheidet sich, den Rahmen der Geschichte (die er in die bundesdeutsche Nachkriegszeit und von Wien nach München versetzte) nur kurz zu skizzieren, um die Kamera immer wieder auf seine Protagonistin Ingrid Bergman zu richten: Wir sehen ihr Gesicht, beobachten ihre Nervosität, ihre Gestik und die angsterfüllte Körpersprache. Der Film zeigt uns alle Stadien von Irenes Hilflosigkeit und Verzweiflung. Und weil sich die grandiose Schauspielerin Ingrid Bergman ihrem Regisseur Roberto Rossellini (der damals ihr Lebenspartner war) vollkommen anvertraut, bewundern wir nicht nur ihr schauspielerisches Können, sondern wir erfahren etwas über unsere Ängste. Dass ein Film beim Betrachter grosse emotionale Erschütterung auszulösen im Stande ist, das war wohl immer schon eine der Attraktionen des Kinos.
Klemens Renoldner, Literaturwissenschaftler und Schriftsteller, leitet seit 2008 das Stefan Zweig Zentrum an der Universität Salzburg (www.stefan-zweig-centre-salzburg.at). Klemens Renoldner stand der Regisseurin Maria Schrader für «Vor der Morgenröte» als fachlicher Berater zu Seite und ist in einer kleinen Nebenrolle (er bittet Stefan Zweig bei der Empfangsszene um ein Autogramm) im Film zu sehen.
 Heute
Heute