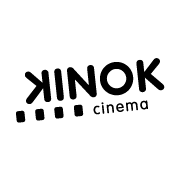Kurdische Filmtage 2016
Kurdistan in der Hauptrolle – der kurdische Film
von Cenk Bulut
«Ich bin an einem Ort aufgewachsen, wo der Bürgerkrieg ein Teil des Alltagslebens war, wo Sicherheit im öffentlichen Raum in Tag und Nacht unterschieden war, in Haupt- und Nebenstrassen, Berge mit Höhlen, Felder mit verbrannten Bäumen. Es war normal, dass Panzer mit schwerbewaffneten Spezialeinheiten im Herzen der Stadt patrouillierten. Für eine Zeitung als Journalist zu arbeiten, war gefährlich genug, um auf offener Strasse am hellen Tag ermordet zu werden. Musik in unserer Sprache zu hören, wurde als Verbrechen betrachtet. Stellen Sie sich einen Ort vor, wo Grundschulkinder verhört wurden, weil sie an einem Zeichenwettbewerb zum Internationalen Tag des Friedens teilgenommen hatten. Aufgewachsen unter den Umständen eines radikal militarisierten Alltagslebens mit sehr beschränkten Mitteln, komme ich nicht aus einem Ort, an dem das Weltbild der westlichen Moral und Ethik als Allgemeingut selbstverständlich war. Ich komme aus einer Gegend, in der ich gelernt habe, wie wichtig das Bewusstsein ist, mehr noch das kollektive Bewusstsein, wenn man sowohl kulturell als politisch isoliert ist.»
Ahmet Öğüt, Bildender Künstler, 1981 in Diyarbakir geboren und aufgewachsen, lebt heute in Amsterdam
Seit einigen Jahren finden im Kinok in Zusammenarbeit mit dem Kurdischen Kulturverein regelmässig Filmtage statt, die aktuelles kurdisches Filmschaffen zeigen und dem Publikum Einblick in die schwierige politische Situation der Kurdinnen und Kurden eröffnen. Jahrzehntelang war es fast unmöglich, kurdische Filme zu realisieren, viele Regisseure wurden deshalb ins Exil gezwungen. Immer häufiger aber sind deren Werke an internationalen Filmfestivals und in Filmzyklen verschiedener Städte präsent und geben so dem kurdischen Volk eine eigene Stimme und eigene Bilder.
Die kurdische Tragödie
Mittlerweile kennt fast jede und jeder die Kurden; sie sind nicht mehr das unbekannte Volk von früher. Tagtäglich berichten die Medien von ihren Erfolgen gegen den Terror des sogenannten Islamischen Staates. Sie sind zu Hoffnungsträgern im Nahen Osten geworden.
Mit dem Vertragsabschluss von Sèvres 1920 wurde die Vierteilung Kurdistans in iranisches, irakisches, syrisches und türkisches Hoheitsgebiet festgelegt. In der Folge wurden die kurdische Sprache und Kultur strengen Restriktionen unterworfen und politische Forderungen mit staatlicher Gewalt unterdrückt. Nicht nur wurden kurdische Literatur und Filme verboten, selbst das «Kurdischsein» stand unter Strafe. Künstlich in Armut gehalten und in gesellschaftlichen Diskursen in sozialdarwinistischer Manier als mindere Wesen diffamiert, versuchten die vier genannten kolonialistischen Staaten, die kurdische Existenz durch Assimilierung in Nichts aufzulösen. Als dies nicht gelang, war ihnen auch das Mittel der physischen Auslöschung recht.
Auch wenn sich die Situation der Kurden im 21. Jahrhundert verbessert zu haben scheint, nimmt ihr Leid damit nicht zwangsläufig ab. Die Autonomie im Irak und die selbstverwalteten Gebiete in Syrien wurden hart erkämpft. Die kurdischen Milizen erweisen sich aktuell als stärkste Einheit im Kampf gegen die faschistoiden Banden des Islamischen Staates. Tausende von Kämpferinnen und Kämpfern liessen ihr Leben beim Aufbau einer sozial egalitären, ökologischeren und demokratischeren Gesellschaft in Rojava (Syrisch-Kurdistan), deren Errungenschaften tagtägliche – auch militärische – Verteidigung verlangen. Die neu errichtete Gesellschaft in Rojava besitzt Symbolkraft dafür, dass die Kurden trotz der erlebten Unterdrückung eine friedliche Koexistenz mit allen anderen Ethnien und Religionen anstreben.
Diese Bestrebungen werden in den letzten Monaten leider seitens des türkischen Staates untergraben. In einzelnen Städten im Südosten der Türkei wurden Ausnahmezonen und Ausgehsperren verhängt. Hunderttausende flohen, Tausende starben bei Militäroperationen, die vorgeblich gegen die PKK, in Wirklichkeit aber gegen die kurdische Zivilbevölkerung geführt wurden. Wieder einmal fühlen sich die Kurden von der Weltgemeinschaft ignoriert und übergangen. Vielleicht werden in naher Zukunft auch über die aktuellen grauenvollen Geschehnisse in der Türkei Filme gedreht. Kaum Trost spendende Aussichten für die unter den gegenwärtigen Repressionen leidenden Kurden.
Der kurdische Film
Es überrascht nicht, dass viele kurdische Filme im Exil entstanden sind. Wie viele andere Kurden sind auch kurdische Filmemacher durch Krieg und Unterdrückung in die Diaspora gezwungen worden. Einige haben auch ihr Studium im Ausland absolviert. Das lange Zeit geltende Verbot der kurdischen Sprache erschwerte Dreharbeiten in Kurdistan. Die unberechenbaren Umstände, denen die Regisseure bei der Realisierung ihrer Werke ausgesetzt waren, schulten jedoch deren Improvisationstalent. Bisweilen mussten sie heimlich drehen oder die Filme im Exil fertigstellen.
Kurdische Filme erlangten auch im Westen Berühmtheit und Anerkennung, so zum Beispiel Yilmaz Güneys Klassiker «Yol» (Der Weg) von 1982, der eine Goldene Palme bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes gewann, und «Turtles Can Fly» (Schildkröten können fliegen) von Bahman Ghobadi, der mehrere Preise erhielt, unter anderem auch eine Nominierung für den Oscar als bester fremdsprachiger Film im Jahr 2005. Waren Güney und Ghobadi lange die einzigen Regisseure mit kurdischen Wurzeln, die international wahrgenommen wurden, so sind in den letzten Jahren vermehrt kurdische Regisseure an internationalen Festivals präsent. Auch wurden in vielen europäischen Städten auf Initiative der kurdischen Diaspora Filmzyklen realisiert, die viel zur Wahrnehmung des kurdischen Filmschaffens beigetragen haben.
Längst reflektieren Filmwissenschaftler und Regisseure, ob kurdischer Herkunft oder nicht, in wissenschaftlichen Arbeiten, journalistischen Artikeln und kritischen Filmrezensionen das Potenzial des Filmemachens in Kurdistan und die Impulse, die der kurdische Film in der Diaspora erhielt – und auch vermittelte. Der kurdische Film hat sich etabliert, in Kurdistan, aber auch im Westen. Dabei hat sich nicht nur die Produktion erhöht, sondern auch ein qualitativer Anstieg bemerkbar gemacht: Vermehrt werden kurdische Filme an Festivals mit Preisen ausgezeichnet.
In Anbetracht der Tatsache, dass jahrzehntelang keine eigenen Filme verfügbar waren, kann man sich vorstellen, wie gross das Bedürfnis der Kurdinnen und Kurden nach eigenen Bildern und eigenen Geschichten ist, und wie wichtig es für sie ist, die eigene Lebenswirklichkeit auf der Leinwand zu sehen. Regisseurinnen und Regisseure wie Künstlerinnen und Künstler geniessen in der kurdischen Gemeinschaft ein hohes Ansehen, insbesondere wenn sie zum Sprachrohr der einfachen Leute werden, die nur allzu oft Gefühlen der Ohnmacht ausgeliefert sind. Nicht zuletzt als Reaktion auf Unterdrückung und Zensur sind die eigene Kultur und die eigene Sprache zentrale Themen im kurdischen Filmschaffen wie auch staatliche Repression, politische Kämpfe, der Kampf gegen archaische Traditionen, Armut, Migration und das Leben in der Diaspora. Nun, da in manchen Regionen ein regelrechter Kinofrühling angebrochen ist und viele Initiativen entstanden sind, ist für die Zukunft des kurdischen Kinos noch einiges zu erwarten.
Cenk Bulut hat den Bachelor in Geschichte und Philosophie und schreibt zurzeit seine Masterarbeit über die Minderheiten- und Fremdenpolitik der Schweiz im 20. Jahrhundert.
 Heute
Heute