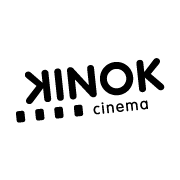Einsame Träumer, gewalttätige Psychopathen und extrovertierte Zampanos
Die leise Kunst des Joaquin Phoenix
von Anke Sterneborg
Er ist einer der aufregendsten und besten, aber auch schwierigen und unberechenbaren Schauspieler, die derzeit in Amerika und gelegentlich auch in Europa arbeiten. Es sind extreme Charaktere, die Joaquin Phoenix in sein Rollenrepertoire aufnimmt: Einsame Träumer wie Theodore in Spike Jonzes «Her» und ein anrührender Ersatzvater wie der Radiojournalist Johnny in Mike Mills «C’mon C‘mon» sind ebenso dabei wie gewalttätige Psychopathen wie Arthur Fleck in «Joker» oder Joe in Lynne Ramsays «You Were Never Really Here». Aber auch extrovertierte Zampanos wie der kiffende Exhippie-Detektiv Doc in Paul Thomas Andersons Pynchon-Verfilmung «Inherent Vice» oder der Comiczeichner John Callahan in Gus van Sants «Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot» finden Platz in dieser oft düster schillernden Filmografie. Allesamt sind sie mehr oder weniger gebrochene Männerfiguren in unterschiedlichen Schweregraden sozialer Defizite und psychischer Defekte.
Vielleicht lässt sich das ausserordentliche Talent von Joaquin Phoenix, die Art, wie er immer wieder tief in die Abgründe der menschlichen Seele eintaucht, am besten am Beispiel des Jokers erklären in Todd Phillips’ Original-Story des berühmten Batman-Antagonisten, eine Rolle, die er sozusagen von Heath Ledger übernommen, aber sehr viel näher an die Realität herangeführt hat. Wenn man ergründen will, wie jemand zum irren Psychopathen wurde, wenn man das Reale im Comichaften, das Menschliche im Wahnsinn freilegen will, dann ist Joaquin Phoenix die richtige Besetzung. Kaum vorstellbar, dass ohne ihn eine Comicverfilmung die Arthouse-Weihen des Festivals von Venedig geholt hätte, den Goldenen Löwen für den besten Film, und weltweit weitere 239 Nominierungen und 121 Preise. Dazu gehörte nach drei Oscar-Nominierungen für seine Seelentrips in «Gladiator», «Walk the Line» und «The Master» endlich auch der erste Goldjunge für Joaquin Phoenix. Zum Fürchten hager und ausgemergelt sieht er da aus, ein Psychowrack am Rande der Gesellschaft, ein erfolgloser Komiker, der eine Kränkung zu viel erlitten hat und vom gedemütigten Opfer zum aggressiven Täter wird, zu einem bösen Rache-Clown mit meckernder Lache. «Joker» erzählt die Schurkenstory als Krankengeschichte, die Bosheit als Ergebnis psychischer Deformationen, Auswuchs all der Probleme, mit denen die Menschheit gerade zu ringen hat, wachsende Ungleichheit, eskalierende Gewaltbereitschaft, Fremdenhass.
Generell führt die konsequente Erdung der Figuren in der Wirklichkeit immer wieder dazu, dass viele der Filme mit Joaquin Phoenix den aktuellen Zustand der Welt mitreflektieren, mit den Folgen der Kriege, dem Versagen von Politik und Gesellschaft, dem Scheitern der Sozialsysteme, der Vereinsamung und Bindungsunfähigkeit des Menschen in der modernen Welt und vor allem der generellen Krise des Männerbildes, die immer wieder dazu führt, dass Kläglichkeit und Verzweiflung in Gewaltbereitschaft umschlagen, beim «Gladiator»-Gegenspieler Commodus ebenso wie beim «Joker» oder im Krimidrama «You Were Never Really Here», in dem Phoenix einen Golfkriegsveteranen spielt, der als so brachialer wie verletzlicher Auftragskiller einen riesigen Hammer zur Waffe seiner Wahl gemacht hat. Als Befreier eines entführten Mädchens aus den Fängen eines Pädophilenrings wird er da zur modernen Version von Robert De Niros «Taxi Driver» Travis Bickle, ein Vergleich, dem nur wenige Schauspieler standhalten könnten. Auch in «The Master» verkörperte er als Freddie Quell einen psychisch und physisch zerrütteten Kriegsveteranen, in diesem Fall ein Rückkehrer aus dem Zweiten Weltkrieg, ein instabiler, unberechenbarer Typ mit aufbrausendem Temperament, gezeichnet von traumatischen Fronterlebnissen, die er in Alkohol, Drogen und Sexsucht betäubt, bis er sich in einen Scientology-ähnlichen Kult namens «The Cause» flüchtet. Kein Lächeln erhellt seine brütenden Züge, kein Zwinkern lockert die Intensität seines Blicks. So sehnig und ausgemergelt wie Joaquin Phoenix hier auftritt, mit gebeugtem Rücken, verspannter Haltung und kantigen Bewegungen, mit tiefen Furchen und dunklen Schatten im Gesicht, verkörpert er mit jeder Faser seiner Erscheinung die verlorene Unschuld des Nachkriegsamerika und eine brennende Sehnsucht nach Erlösung. So fügt er sich in die Reihe der einsamen Exzentriker, die in den Filmen von Paul Thomas Anderson auf einem schmalen Grat zwischen Selbstüberschätzung und Minderwertigkeitskomplexen, Obsession und Wahn balancieren, auf ihrer Suche nach materiellem Reichtum und seelischem Heil.
Geboren wurde Joaquin Phoenix 1974 als Joaquin Bottom in Puerto Rico, wo seine Eltern sich als Missionare der «Children of God»-Bewegung engagierten. Als die Familie Ende der 1970er-Jahre nach Kalifornien zurückkehrte, änderte sie den Familiennamen als Zeichen des Neuanfangs von Bottom in Phoenix. In den Achtzigern mussten die fünf Geschwister, darunter auch der früh verstorbene, ältere Bruder River Phoenix, als Kinderdarsteller zum Unterhalt der Hippiefamilie beitragen, mit kleinen Rollen in Fernsehserien wie «Seven Brides for Seven Brothers», «Ein Colt für alle Fälle» oder «Mord ist ihr Hobby»: «Ich war sehr jung, als ich anfing, und das war eine grandiose Erfahrung, die einen unauslöschlichen Eindruck auf mich gemacht hat, ein enormes Vergnügen, eine Kraft, die durch meine Adern pulsierte. Damals fühlte ich mich ermächtigt, stark, durch nichts eingeschränkt, das war die äusserste Form der Freiheit. Das waren Momente, denen man immer wieder nachjagt: So will ich mich fühlen!»
Doch Ende der Achtzigerjahre war der Zauber verflogen, die angebotenen Rollen erschienen Phoenix zu seicht und uninteressant, und eine Weile sah es so aus, als würde er die Schauspielkarriere gegen ein Leben als Skateboard-Profi eintauschen, ein Plan, den er nach einer Verletzung aufgeben musste. 1995 war es dann Gus Van Sant, der ihn wieder vor die Kamera holte. In der Mediensatire «To Die For» spielte er den White-Trash-Jugendlichen Jimmy Emmett, den ersten von vielen verdruckst gehemmten Sonderlingen an den sozialen Rändern der Gesellschaft. Blauäugig verknallt er sich in Nicole Kidmans narzisstische Wetterfee und wird von ihr in den Ehegattenmord hineinmanipuliert. Aus kleineren Thriller-Rollen als eifersüchtiger TNT-Tucker («I’m just like dynamite and when I go off, somebody gets hurt») in Oliver Stones «U Turn» und in Joel Schumachers «8MM» als kleinkrimineller Sex-Shop-Angestellter, der den von Nicholas Cage gespielten Privatdetektiv in die Snuff-Porno-Szene einführt, werden zunehmend grössere. Da er mit seinen kantigen Zügen, der Narbe auf der Oberlippe und der gekrümmten Schulter nicht wie ein klassischer Teeniestar aussah, konnte er sich in aller Ruhe zum Charakterdarsteller mit düsteren Untertönen entfalten.
Der endgültige Durchbruch kommt für den 26-Jährigen, der da schon 18 Jahre vor der Kamera agiert, im Jahr 2000 mit Ridley Scotts überraschendem Revival des Sandalenfilms in «Gladiator». Sein Kaiser Commodus ist die erste grosse Rolle, in der Phoenix einen Mann spielt, der aus Wut über erlittene Demütigungen gewalttätig wird und widersprüchliche Gefühle spannungsvoll gegeneinander ausspielt. Zutiefst enttäuscht, dass sein Vater nicht ihn, sondern seinen Freund, den Feldherrn Maximus, zum Nachfolger erkoren hat, wird der übergangene Sohn zum Vatermörder und Freundesverräter, und Phoenix sorgt dafür, dass man ihn nie nur verachten kann, dass man hinter seiner Armseligkeit, Schwäche und Niedertracht immer auch die menschliche Verzweiflung spürt.
Immer mehr Regisseure sind von dem jungen Darsteller so fasziniert, dass sie ihn mehrfach besetzen, so wie M. Night Shyamalan in seinen Mystery-Thrillern «Signs» und «The Village»», wie Terry George im Politthriller «Hotel Rwanda» und im Fahrerflucht-Drama «Reservation Road». Oder wie James Gray, der ihn fast parallel zu Scotts «Gladiator» zum ersten Mal in «The Yards» besetzt und danach noch in «We Own the Night», «Two Lovers» und «The Immigrant». In höchsten Tönen schwärmt der Regisseur von dem Schauspieler, mit dem er wiederholt die Abgründe der Condition humaine ausgelotet hat: «Er bringt den Kampf gegen die dunkle Seite auf die Leinwand. Ich vergleiche ihn mit Montgomery Clift, der auch immer gequält wirkte, und mit Marlon Brando natürlich. Er bewegt sich in dieser Klasse, weil er fähig ist, innere Konflikte sichtbar zu machen. Wenn ein Schauspieler es schafft, auf der Leinwand zu zeigen, was er denkt, dann ist das eine kraftvolle Waffe.» Joaquin Phoenix gehört zu den Schauspieler:innen, die nichts sagen und scheinbar nichts machen müssen, um ergreifende Gefühle zu vermitteln. Eine kleine Träne, die aus den Augen über die Wange rinnt, reicht, um herzzerreissende Abgründe zu eröffnen.
Nachdem Joaquin Phoenix 2005 aufsehenerregend den zwischen Country-Coolness, Sex-Appeal und inneren Dämonen schlingernden Johnny Cash verkörpert und drei Filme mit James Gray und Terry George realisiert hatte, verkündete er 2009, sich aus dem Filmgeschäft zurückzuziehen, um fortan eine Rapper-Karriere zu verfolgen, was sich später als Scherz herausstellte, als Vorwand für das unter der Regie seines Kollegen und Schwagers Casey Affleck entstandene Mockumentary «I’m Still Here».
Nach der heilsamen Pause von zwei Jahren legt er wieder richtig los, arbeitet zweimal mit Paul Thomas Anderson («The Master» und «Inherent Vice») und zeigt unter der Regie von Spike Jonze in «Her» eine ganz neue Seite als versponnener Eigenbrötler und romantischer Träumer mit gebrochenen Herzen. In einer nicht allzu fernen Zukunft lässt sein Theodore Twombly nicht ausgelebte Sehnsüchte und Gefühle in Briefe fliessen, die er als Lohnschreiber für fremde Leute verfasst. Eines Tages schafft sich Theodore ein sogenanntes OS1 an, eine künstliche Intelligenz, die sich Samantha nennt. Sie fängt zunächst ganz sachlich an, sein Leben zu organisieren, seine Korrespondenzen zu verwalten, seinen Computer aufzuräumen, schleicht sich aber zunehmend in sein Herz, lacht über seine Scherze, flirtet mit ihm. So entwickelt sich eine irritierend zauberhafte Liebesgeschichte zwischen einem Mann aus Fleisch und Blut und einem körperlosen Computerprogramm, das im Original die erotisch knisternde Stimme von Scarlett Johansson hat. Für Phoenix bedeutet das, dass er über weite Strecken dieses betörenden Films in den leeren Raum spricht, ein nicht sichtbares, aber sinnlich spürbares Gegenüber nur mit den feinen Nuancen seiner Stimme und seiner Mimik entstehen lässt. Damit ist «Her» eine hinreissende Liebesgeschichte und zugleich eine Hommage an die menschliche Fantasie und Kreativität, die aus dem Nichts eine Figur entstehen lassen kann. Unterschwellig aber ist es auch eine poetisch kluge Kritik am modernen Lebensstil, in dem menschliche Kontakte zunehmend durch Maschinen ersetzt werden.
Ein wenig hat man das Gefühl, dass sich der scheue Joaquin Phoenix hinter den oft extremen Outfits, wilden Haaren und wuchernden Bärten seiner unterschiedlichen Rollen versteckt: mit Lorbeerkranz auf kurzem Haar als römischer Kaiser Commodus in «Gladiator». Mit Backenbart und Sonnenbrille als Privatdetektiv in der fiebrigen Seventies-Drogen-Krimi-Komödie «Inherent Vice». Mit langer Matte als Jesus in «Maria Magdalena» oder mit struppig in alle Richtungen wucherndem, karottenorangem Haarnest in «Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot». Nein, ums Verstecken gehe es ihm gar nicht, erzählte er im Interview: «Eher im Gegenteil. Es geht darum, dass die Figur eine äussere Form annimmt, in der sie ihr Innerstes offenbaren kann, und in gewisser Weise – durch die Figur – auch ich mich selber.» Demnächst zu bewundern im neuen Film «Beau Is Afraid» von Ari Aster, in einem weiteren «Joker»-Kapitel von Todd Phillips, in «Kitbag», wo er für Ridley Scott Napoleon Bonaparte verkörpern wird, und in «The Island» von Pawel Pawlikowski.
Anke Sterneborg, 1960 in Erlangen geboren, lebt in Berlin. Studium der Kunstgeschichte, Theaterwissenschaft und Publizistik in München und Berlin. Seit 1989 freie journalistische Arbeit über Film und Kunst u.a. für Süddeutsche Zeitung, rbbKultur Radio, ZEIT online, epd Film. Diverse Veröffentlichungen u.a. in Reclam Filmklassiker, Katalog der Retrospektive «Traumfrauen», Film-Konzepte Roman Polanski und Michael Haneke. Katalog Birgit Brenner, Wolfsburg 2021.
 Heute
Heute