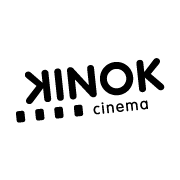Daniel Schmid: Poesie und Pathos
von Stefan Zweifel
Weiss tänzelnd vor einer Horizontlinie, die sich zwischen Wasser und Himmel verliert, in sich versunken und zugleich voll Ausdruck, so schwebte der 88-jährige Tänzer Kazuo Ōno aus Daniel Schmids Film «The Written Face» vor einem Jahr über die erste Wand in der Ausstellung «Dance Me to the End of Love» über den Totentanz im Kunstmuseum Chur. Fast schon visionär hat Daniel Schmid in dieser Sequenz unsere Sicht auf den Totentanz vorweggenommen, der eben immer auch eine Hymne ans Leben ist, voll Ekstase zwischen Eros und Thanatos. Denn der greise Tänzer, dessen Hände wie verwelkende Blumen vor den Wellen des Meeres flirren, steht an der Schwelle von Leben und Tod, Land und Wasser, Mann und Frau. Ein Zwischenwesen wie unser ganzes Leben. Solche Bilder voll Pathos, in denen eine philosophische Sicht aufs Leben und die sinnliche Lust am Leben verschmelzen, könnte man in jedem Film von Daniel Schmid finden. Immer wieder wagte er die grosse Geste. Und so wurde sein Film zum Zentrum dieser Ausstellung – aber ganz und gar nicht museal, sondern vom Leben durchpulst.
So war es auch in der Nacht nach seinem Tod, als in Locarno zu seinem Gedenken der Film «Il bacio di Tosca» auf der Piazza gezeigt wurde. Ich erinnere mich, wie sein Pathos mitten ins Leben sprang: Zwei junge Frauen drehten sich links vorne auf der Piazza Grande im Kreis, zur Musik von Verdi tanzend, traumverloren wie die alten Operndiven auf der Leinwand, die die Brüchigkeit ihrer Stimmen durch nie zu stillende Sehnsucht überspielen – und darüber der Sternenstaub. Es war nach Mitternacht, die Stunden, in denen man immer wieder an Daniel Schmid denken wird und ihn vermisst – wie er hereinstürmen konnte ins Café Odeon in Zürich. Plötzlich stand er da in seiner schwarzen Lederjacke, schwang sich vom Fahrrad und erzählte von seiner letzten Reise nach Paris oder Berlin. Eine Katze der Nacht – wie es der Dokumentarfilm «Le Chat qui pense» vermittelt. Schon bestellte er einen Rum Cola und zischte einem etwas ins Ohr: «Shanghai» oder «Marseille», die Namen von Hafenstädten, wo jeden Augenblick ein Schiff voller Sehnsucht das feste Land verlässt – schwimmende Hotels, in denen alle Menschen aufeinander angewiesen sind, um die Langeweile zu vertreiben. Genauso wie sein Leben als Kind im Hotel seiner Eltern in Flims. Ein Luftmensch aus den Bergen! Wenn es dem kleinen Daniel unten in der mondänen Gesellschaft des Speisesaals zu eng wurde, flüchtete er hinauf in die Dachstube des Grand Hotels, wo die Spinnen der Erinnerung ihre Netze auswarfen – er verfolgte deren Schatten und übersetzte sie ins Jetzt.
Schmid sprengte die Grenzen der Schweiz. Filmte auf Deutsch, Italienisch, Französisch, Englisch. Er war in Zürich zu Hause, aber auch in Paris und in Kyoto, in Berlin und in Cannes. Das machte ihn vielen Schweizern verdächtig. Doch zuletzt bezauberte er sie alle mit der Magie seiner Bilder und Emotionen, deren Spannungsbögen in den Himmel reichen und Luftwurzeln treiben.
Heute Nacht oder nie! So hiess sein Film von 1972 programmatisch: Heute Nacht muss das Leben beginnen. Heute Nacht in Paris oder in Berlin, in das Daniel Schmid mit 19 Jahren kam, aus den Schweizer Bergen flüchtend und nach einem Sprung ins mystische Grün des heimischen Caumasees im Lichterglanz der Grossstadt auftauchend. Dort wohnte er in einer WG mit dem späteren RAF-Terroristen Andreas Baader, von dem er eigentlich nur erzählte, wie schön er gewesen sei. Es war die Zeit nach 68, als alle ihr politisches Gewissen wie ein Plakat vor sich hertrugen, er aber hängte Opernbilder und die Affiche von «La Paloma» mit Ingrid Caven an die Wand. Mit diesem Film gelang ihm 1974 der Durchbruch in Cannes: Eine Parabel über die Liebe, die in einem einzigen Augenblick das ganze Leben zur Tragödie verdichtet. Grosse Opernarien und Postkartenkitsch. Auch Ingrid Caven feierte mit dem Film ihren Durchbruch, und nach ihrem Chanson-Abend im Pariser «Pigalle», den Schmid inszenierte, lagen ihr Yves Saint Laurent und ganz Paris zu Füssen.
So wechselte Schmid mit seinen Filmen spielend die Etagen wie seine Familie in Flims, die in der Zwischensaison in den noblen Zimmern der ersten Etage residierte und in der Hochsaison in die Dachkammer auswich: Er drehte radikale Avantgarde-Filme wie «Thut alles im Finstern» (1970), Dokumentarisches wie «Il bacio di Tosca» (1982), Schweizer Mythen wie «Violanta» (1977) mit dem jungen Gérard Dépardieu, Autobiografisches wie «Hors saison» (1992), wo Dieter Meier von «Yello» am Klavier sass, und Komödien fürs breite Publikum wie «Beresina» (1999).
Immer aber wendet sich Schmids Blick voll Zuneigung jenem unförmigen Rest zu, der bei allen Rechnungen der Vernunft übrigbleibt, jenen verfemten Teilen der Gesellschaft, die das Verdrängte verkörpern, den Huren und Transvestiten, dem Chanson und dem Kitsch, der aus der hohen Kunst ausgeschieden wird. Nur aus den Niederungen und den Brüchen des Lebens kann jene wahre Poesie affektiv geladener Bilder entstehen, die der grosse französische Philosoph Gilles Deleuze in seinem zweibändigen Werk über den Film «images affections» nannte und meinte: Darin brilliere Daniel Schmid ganz besonders.
In solche Gefühlsbilder bettete er 1982 Lauren Hutton in «Hécate». Der Held zerbricht daran, dass er den Mut nicht aufbringt, an der schönen Oberfläche von Clothilde stehen zu bleiben, und so verirrt er sich in den Gassen und Gässchen der fremden Stadt auf der Suche nach ihrem Geheimnis, er will und will nicht wahrhaben, dass die Liebe wie der Film eine reine Projektion ist, die auf dem Gesicht des anderen abläuft, und verrennt sich im Labyrinth der eigenen Leidenschaft. Wie ein Klischee aus einem alten Hollywood-Film lehnt Clothilde am Geländer, sie ist «nur eine Frau, die die Nacht betrachtet», nichts weiter; er aber findet aus dieser Nacht nicht mehr hinaus. Seine konventionelle Sicht aufs Leben ist von der strengen Geometrie der Jalousien und der Eifersucht vergittert; sie aber lässt sich «vom Leben treiben», wallt wie die Gardinen im heissen Hauch der Wüstennächte, während es ihm die Kehle zuschnürt. Sein Untergang ist es, dass er versucht, sie zu verstehen und die Liebe zu verstehen. Denn es gibt nichts zu verstehen – und wieder gelingt Schmid eine Sequenz voll Pathos, die man in einem Museum als Auftakt für eine Ausstellung über das Rätsel der Liebe zeigen könnte: Zwei Schatten, die, an die Wand geworfen, Liebe machen, ins bläuliche Licht eines Aquariums getaucht. Verzweifelt reisst der Mann Clothilde aus der Badewanne: «Tu n’es plus une femme … Mais qui es-tu?», wirft sie hin und her, während ihre Haare wie Algen auf den Kacheln des Badezimmers liegen und der Kopf als fremdes Seegetier selig lächelt, da die dionysische Lust auch die Lust an der eigenen Vernichtung in sich schliesst. So perfekt Clothildes Gesicht zur makellosen Maske gestrichen sein mag, der Widerstand der Materie ist nicht zu überwinden, in den Hautfalten schlummert unausweichlich der Tod. Die Dialektik der beiden Seiten Eros und Thanatos lässt sich nicht überwinden – der Mensch lebt und liebt im Zwiespalt.
In «Il bacio di Tosca» wendet er sich den verknitterten Gesichtern in der «Casa Verdi» zu, wo ehemalige Operndiven dem Tod entgegendämmern und ihre brüchigen Stimmen «O sole mio» zum klirrenden Klingen bringen. Der ätherisch-ästhetische Kuss der Tosca wird vom mahlenden, unkontrolliert zuckenden Kiefer der alten Sängerin zu einem Todeskuss verzerrt: «Questo è il bacio di Tosca!». Die Lebensträume verstauben im Dachstock, die Figuren verwickeln sich in den Spinnweben des gelebten Lebens, bis sie zuletzt mumifiziert in ihrer Trauer erstarren, aus der sie erst durch den Film wieder geweckt werden, indem ihre Falten nicht als Makel und Mangel, sondern als Vielfalt wahrgenommen werden. Bereits winkt der alte Pianist in der «Casa Verdi» ab, doch dann spielt er nach einem kurzen Stocken weiter, und in der gemeinsamen Ekstase wird die Hässlichkeit des Gesangs zu einer Hymne ans Leben.
Diese Feier des Lebens lernte er gerade auch in Paris kennen, wo Schmid jahrelang lebte. Zuweilen lag er Opium rauchend im Salon der Vicomtesse de Noailles – er ging immer wieder hin, ohne zu wissen, weshalb. Das merkte er erst, als seine Mutter starb und er, in die Berge zurückkehrend, die Wucht des Entzugs spürte. Die wandelnde Kraft des Opiums verströmte er, Jahrzehnte später, als ich mit ihm durch Paris schweifen durfte. All die Ecken erkundend, wo die Fantasie frei wird. Gerade noch hatte er im Musée d’Orsay nicht die gelb gepeitschten Felder von van Gogh betrachtet, sondern aus einem Fenster hinüber auf die weiss gleissende Sacré-Coeur geblickt, Kirche des Kitschs, aber eben immer noch ein Bubentraum. So glitt er durch die Welten der Kunst und des Kitschs, ganz ohne Vorurteil beides geniessend. Und glitt auch zwischen den Zeiten. Denn schon setzte sich im Café Flore eine alte, wild geschminkte Dame an seinen Tisch, die einst in den 1950er-Jahren in den Kellern der Existenzialisten tanzte und später eine Nacht mit Jim Morrison verbrachte. Ob das wahr war? Egal, Hauptsache es befeuert die Vorstellungskraft und hebt die Schwerkraft des Geistes auf, die Starre der Ideologien.
So streng geschnitten sein Gesicht war, so wild ausufernd seine Fantasie. Und der Tanz seiner Ideen und Einfälle zeigte stets, dass in jedem Augenblick alles ganz neu beginnen kann. Gerade wollte man aufs Leben schimpfen, sich voll Wut über all jene äussern, die einem Hindernisse in den Weg legen, aber wie er auf der Piazza bei der Verleihung des «Ehrenleoparden 1999» sagte: Den Verhinderern dankt er genauso wie denen, die ihm halfen, denn der Widerstand hat ihn stark gemacht. Schimpf? Nein! – Schnitt! Mit der nächsten Szene beginnt alles wieder von vorn, voll Lust. Die Feier des Jetzt ins Flimmern jener Bilder gebannt, die die Welt als Fata Morgana der Möglichkeiten aufscheinen lassen und uns immer wieder – das Leben retten.
Stefan Zweifel ist Autor, Übersetzer, Journalist und Ausstellungskurator. Er war mehrere Jahre Teilnehmer der Sendung SRF Literaturclub und moderierte diese von 2012 bis 2014. Er schreibt Beiträge u.a. für die Neue Zürcher Zeitung, Du und die Republik.
 Heute
Heute