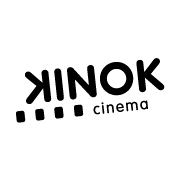Fellini, Inklusionsartist
von Christoph Keller
«Hier gibt es nichts anderes als das, was Sie sehen.»
Federico Fellini im Interview (1982)
(Idealerweise hört man sich während der Lektüre dieses leicht ekstatischen Textes Nino Rotas «La Passerella di Addio» aus «Otto e mezzo» an.)
Über Fellini schreiben ist eigentlich unmöglich. Womit beginnen? Mit welchen Worten das Felliniglück, das sich beim Betrachten seiner Filme einstellt, beschreiben? Ich spüre es, seit ich als etwa Siebenjähriger zum ersten Mal gesehen habe, wie sich Gelsominas Gesicht übergangslos von todtraurig zu übermütig fröhlich verwandelt.
Überschwang kommt mir als Erstes zu Hilfe, Fantasie, die überbordet, über die Ufer tritt und das Flachland überflutet. Vorstellungskraft, die sich überschlägt, die überwältigt, die über die Stränge schlägt. Übertreibung, Übermut, Überschreiten der Grenzen, Übersetzen von einer Welt in eine andere, die auch unsere ist, nur sehen wir sie nicht. Vielleicht ist es Fellini deshalb nie gelungen, seinen überirdischsten Film, «Die Reise des G. Mastorna», um- oder eben überzusetzen: jene Reise, die mit dem Tod beginnt, die zwar die unsere sein wird, es aber noch nicht ist. So oder so, es muss etwas mit «über» zu tun haben.
Mir kommt auch das Bild eines Bergsturzes in den Sinn. Damit ein Dorf wieder auferstehen – überleben – kann, muss es manchmal begraben werden. Bei FF gibt es solche Wiedergeburten. So wird eine Kapelle, in der eine Orchesterprobe stattfindet, von einer Abrisskugel zerstört. Ob sich darauf «das Dorf» – in diesem Fall Italien – erneuern wird, überlässt der Film der politischen Wirklichkeit.
Vieles ist übersinnlich oder einfach nur sinnlich, göttlich komisch, höllisch traurig oder an Chaplin geschulter Slapstick. Manchmal läuft ein Pferd vorbei oder ein Rhinozeros steht in einer Ecke. Christus lauert an allen Wänden, da muss er ja irgendwann an einem Helikopter hängen und über Rom schweben. Der kostümgeile Vatikan lässt sich von Models vorführen, was der letzte Schrei in katholischer Mode ist. Als Gottesbeweis aber taugt immer noch am besten die Existenz des Teufels, und schon steht er überlegen grinsend auf der Brücke, auf der Toby Dammit, der Frevler, wegen einer dummen Wette gleich seinen Kopf verlieren wird.
Die Clowns sind traurig, die Müssiggänger melancholisch, die Huren und Nonnen archetypisch, die Nonnen aber modischer. Das Seemonster ist aus Plastik, später auch das Meer. Aus einem Paparazzo werden zahllose Paparazzi, die viel später die Prinzessin in den Tod jagen, aber trotzdem ihr lüsternes Spiel weitertreiben, und Casanova vögelt schliesslich auch noch eine mechanische Puppe – pfui! Der Allerweiseste ist der Dorftrottel, auch wenn er in seinem Karren nur einen Kitschengel vor sich herschiebt, der Allergöttlichste der Arm- und Beinlose, dessen Talent das Orakeln ist. Überweiblich die Ekberg, übermännlich der Mastroianni, überschön die Cardinale, alle letztlich aber auch nur Freaks der Natur – wie wir alle. Wir sind der Zirkus, das Varieté, die Party auf der Piazza, das Strassentheater, die Karnevals, das Leben jenseits der Leinwand eben.
Das, liebe Cineasten, liebe Mitmenschen, ist die Welt nicht nur, wie sie Fellini zeigt, sondern wie sie wirklich ist. Alles ist übertrieben. Alles ist normal.
Der radikalste Einstieg in das Felliniversum, in dem alle willkommen sind, ist «Satyricon», dieser «Sci-Fi-Film aus der Vergangenheit», wie ihn FF bezeichnet hat. Es ist eine eigensinnige Variation des anything goes der Hippies, die den Film liebten, wie es im Film auch der Frühhippie Encolpio praktiziert. Doch ist es noch nicht eine Ideologie – die der intoleranten Durchsetzung der Toleranz –, sondern eine alles umfassende, alles willkommen heissende, nichts ausschliessende Lebensbejahung, die das ganze Werk Fellinis auszeichnet und verantwortlich ist für das Felliniglück, das sich beim Fellinischauen so zuverlässig einstellt.
Ah, Diversität! Oh, Inklusion, und was die unerotischen Akademiker*innen und die immer weniger sexy Politischkorrekten sich sonst noch alles zur Dramatisierung unserer Lage ausdenken! Alles schon da bei FF! Bei «Satyricon», diesem safe space für alle, radikaler noch als bei anderen seiner Filme, hat er die Vielfältigkeit dem Film bereits bei der Besetzung in die DNA geschrieben. Der Regisseur schöpft aus dem Übervollen des Lebens. Penner, Prostituierte, Zigeuner, Matronen, kleine und grosse Monster greift er sich von der Strasse, Alte aus dem Altersheim, Irre aus dem Irrenhaus, Krüppel aus dem Krüppelhaus. Das Leben auf der Leinwand wird unendlich vielfältig, so normal es eben im «wahren Leben» zu und hergeht.
In «Fellini Satyricon» mischen sich Amateure unter die Schauspielerprofis, wer wirklich nicht schauspielern kann, dem befiehlt der Regisseur-Demiurg möglichst unbeweglich die Visage zu präsentieren. Längst ist der einstige Neorealist zum Verräter des Neorealismo geworden. Den ohnehin schon ausserordentlichen Gesichtern lässt er so viel Make-up auftragen, dass sie zu Fratzen werden, bis sie vor Leben (und Lust) strotzen, während die meisten Szenen des Films im Studio gedreht wird. Die Kulissen sollen unecht erscheinen, schliesslich sind sie ja Kulissen, die sich mit Licht und Farbe in Szene setzen lassen. «Satyricon» ist eine zweistündige Videoinstallation, eine Performance, die sich durch ein imaginäres Museum bewegt.
Auf diese Weise gehorcht Fellini einem archaischen, längst verdrängten menschlichen Ideal, das der wahren Gemeinschaft. Seine Quelle, ob er nun von ihr weiss oder sie instinktiv beschwört, ist die Weisheit der alten Völker. Diese (ich denke vor allem an die nordamerikanischen) haben im Anderssein nichts Nachteiliges gesehen, für «Behinderung» gar nicht erst ein Wort gehabt. Was für uns Defizite geworden sind – weil wir für alles ein Wort haben? –, waren für diese Völker Talente, die, gefördert von der Gemeinschaft, zu deren Wohl eingesetzt wurden. Für Irre nicht das Irrenhaus, sondern ein Platz im Dorf als Schamane, der das Leben aller mit seinen Visionen bereicherte. Die Lahme vermochte es, als begnadete Geschichtenerzählerin zu glänzen, der Taube war zum Beispiel ein Meister im Hüttenbauen.
Ach, arme, nicht allerschlauste Gelsomina, in jener Gemeinschaft wärst du die lustigste aller traurigen Clowns gewesen! Du hättest so glücklich sein können, hättest so viele glücklich machen können!
Ich glaube, das ist es, die Wucht dieser archaischen Gerechtigkeit, die uns so berührt, wenn wir einen Fellinifilm sehen: Uns allen könnte geholfen werden.
Fellini beglückt uns mit einer Welt, in der das Anormale durch seine schiere Überfülle an Vielfalt normal wird. Keiner wird weggestossen, ausgeschlossen, eingesperrt oder sonst irgendwie unsichtbar gemacht – denn alle sind hier.
Darf ich vorstellen: Federico Fellini, der grosse Inklusionsartist.
Auf den Punkt bringt er den ganzen normalen Wahnsinn, den wir «Leben» nennen, mit dem Film, den er gleich nach «Satyricon» gemacht hat, dem wunderbaren Fernsehfilm «I clowns». Mögen auch die Bretter die Welt bedeuten und wir alle Schauspieler sein, wahrer wird hier, dass der Sand der Manege die Welt ist und wir alle Clowns, die darin herumtoben. Der Zirkus ist Fellinis Welt. Die Welt ist rund wie die Zirkusmanege, sie dreht und dreht sich, eine permanente Beschleunigung, eine sich immer schneller drehende Glücks- und Leidensspirale.
Was in «I clowns» schon früh intoniert und parodiert wird – kein glückliches Leben ohne Selbstironie –, findet bereits als nicht endend wollende Ekstase als Ende von «Otto e mezzo» statt. Die Menschenparade, dirigiert von einem federicoähnlichen Impresario, bewegt sich tapfer vergnügt zur Tonkulisse von Nino Rotas unwiderstehlicher «Passerella di Addio» fort. Dieses Filmende, Fleisch und Blut gewordene Lebenslust, ist das alle willkommen heissende Felliniglück. Wer, auch ohne den Kinosessel zu verlassen, mitschreitet – oder rollt oder stolpert oder kriecht –, der weiss, was Glück ist. Felliniglück oder einfach Glück.
Christoph Keller lebt und arbeitet als Schriftsteller in St.Gallen. Zuletzt erschienen die von ihm herausgegebene Anthologie «Russian Stories» in der Everyman’s Library und der Roman «Der Boden unter den Füssen» im Limmat Verlag. Am 4. Februar führt er in «Amarcord» ein.
 Heute
Heute