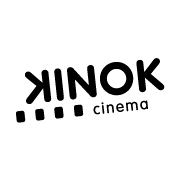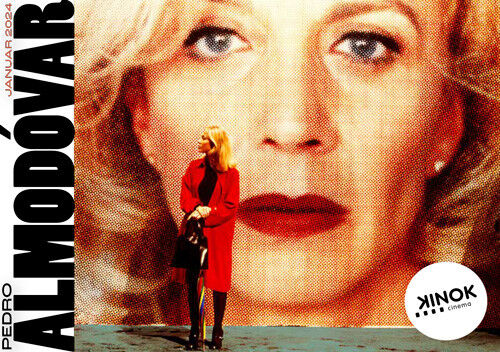
Die Wahlverwandtschaften
von Bert Rebhandl
Pedro Almodóvar ist der Filmkünstler des freien Europa – mit allen Schmerzen, die damit einhergehen
Wenn ein Kind auf die Welt kommt, wird es meistens zuerst einmal bestaunt. Dann aber beginnt sofort die Arbeit der Identifizierung: Ganz der Papa! Aber die Augen hat es von der Mama! Es gibt einen Wunsch nach Ähnlichkeit, dem das Gesicht eines Babys meist gar nicht entsprechen kann. Es braucht ja eine Weile, bis es allmählich Züge bekommt. In höherem Alter wird man dann tatsächlich oft beim Blick in den Spiegel damit konfrontiert, dass man einem Elternteil äusserlich geradezu verblüffend ähnlich geworden ist. In Pedro Almodóvars Film «Madres paralelas» gibt es, wie der Titel schon andeutet, auch parallele Babys. Die ganze Geschichte von Janis und Ana aber läuft darauf hinaus, dass sich Menschen eben selten in Form von Parallelogrammen zusammentun. Sondern dass andere, schiefe Verbindungen entstehen, dass die Orthodoxie von Vater-Mutter-Kind immer wieder gebrochen wird. Dass kompliziertere, aber auch reichere Familien entstehen.
Janis und Ana treffen in einem Spital aufeinander. Sie teilen nach der Niederkunft ein Zimmer, zwei ganz unterschiedliche Frauen. Janis ist eine erfolgreiche Fotografin in mittleren Jahren, sie lebt allein, das Kind hat sie mit einem verheirateten Mann gezeugt, der sich auch gleich zurückzieht. Ana erzählt erst einmal gar nichts über die Umstände ihrer Schwangerschaft, sie hütet ein Geheimnis, das Almodóvar bald mit einem noch grösseren verbindet. So entsteht beinahe wie von selbst eine melodramatische Konstellation: zwei alleinerziehende Frauen in vielfachen Bezügen, verbunden und getrennt durch Ereignisse, in die deutlich auch Motive aus Groschenromanen eingeflossen sind. Oder aus den Märchen, den Schätzen eines kollektiven Unbewussten.
Pedro Almodóvar ist der Regisseur des demokratischen Spanien. Er begann seine Karriere just, als das Land endlich – sehr spät – die katholische Feudalgewalt abschütteln konnte. Jetzt, in seinen reifen Jahren, sieht man den Filmen an, dass Spanien durchaus eine Erfolgsgeschichte ist: Die Lebenswelten verkünden Wohlstand, wenn auch manchmal mit verwegenem Geschmack. Almodóvar ist schwul, er ist ein Regisseur der Frauen, und nachdem er über viele Jahre lang alle möglichen Tragödien und Traumata zwischen sexueller und nationaler Identität, zwischen Metropole und Provinz, zwischen Schmerz und Ekstase durchgearbeitet hat, zielt er mit «Madres paralelas» auf eine Familie, die alles in sich aufnehmen kann, was die konservative Engführung auf die «herkömmliche» Verbindung von Vater und Mutter nicht gut verträgt. Es ist eine queere Familie.
Sie ist auch eine Summe seines Lebens als Erzähler und Filmkünstler. Die Vergangenheit ist in seinen Filmen nicht nur nie vergangen, sie verschafft sich immer wieder eine körperliche Präsenz, indem sie das Leben von Menschen buchstäblich über den Haufen wirft. Die vielen Facetten der Sexualität (hetero, homo, trans) sind für ihn keine Alternativen. Sie sind Formen des Übergangs zwischen damals und heute, zwischen Kindheit und Gegenwart, zwischen Trauma und Therapie, zwischen Lust und Behinderung. Manchmal sogar zwischen Leben und Tod. Der bedeutendste spanische Filmemacher der letzten vierzig Jahre ist ein Gestaltwandler, dem das Kino die Möglichkeiten gibt, immer wieder in neue Geschichten zu schlüpfen und sich in ihnen so zu verstecken, dass sich ein ganzes Land darin wiedererkennen kann. Und längst auch ein ganzer Kontinent, der auch für eine gefährdete Gesellschaftsform steht: das freie Europa.
In «Julieta» erfährt eine Frau just in dem Moment, in dem sie von Madrid nach Portugal ziehen will, dass ihre Tochter in Italien lebt. Die Netzwerke über den Kontinent führen immer zu einem Kern zurück. Es gibt eine Zeit im Leben, in der ist alles offen, und dann gibt es eine Zeit, in der ist manchmal nur noch eines offen: die grosse Wunde, die das Leben geschlagen hat. Und so ist der Film «Julieta» ein Spiel mit diesem zentralen Motiv des Melodrams und der Psychoanalyse: Die Spur führt immer zurück in den Schmerz. Der Schmerz aber birgt das Höchste der Gefühle, die wahre, grosse Liebe, oder zumindest die unvergessliche Leidenschaft.
Pedro Almodóvar hat mit seinen Filmen selbst eine Bewegung vollzogen, die er in «Julieta» nach rückwärts wieder aufgreift. Die Kultur war in Spanien der politischen «transición» voraus, sie löste die Versteinerung in überschwängliche Bewegung auf. Diese «movida» einer unbezähmbaren Avantgarde, vor allem in Madrid, fand im frühen Almodóvar ihren herausragenden Vertreter. «Mujeres al borde de un ataque de nervios» ist ein Filmtitel, der sprichwörtlich geworden ist: überschwängliches Leben bis an den Rand der Hysterie. Eine der Schauspielerinnen damals war Rossy de Palma, sie blieb über viele Jahre eines der markantesten Gesichter im Almodóvar-Universum. In «Julieta» spielt sie eine eisige Haushälterin.
Das Melodram ist das Filmgenre, in dem die Gefühle (vor allem von Frauen) mit einer Welt abgeglichen werden, die dafür eigentlich zu klein ist. Gerade dieses Missverhältnis hat Pedro Almodóvar zu einem der grossen Filmemacher werden lassen. Er ist, wie auf eine ganz andere Weise vielleicht nur noch Lars von Trier, dazu in der Lage, die inneren Welten mit den äusseren zu verknüpfen, aber während der manisch-depressive Skandinavier für die äusseren Welten ins Mythologische und Archaische ausgreift, ist Almodóvar auch ein Chronist der modernen Lebenswelten. Bei ihm sehen die Wohnungen in Madrid und Barcelona, die Strassenecken und Verlagsbüros immer so aus, als hätten sie von fern noch mit den künstlichen Welten zu tun, in denen das Melodram einmal seine eigentliche Heimat hatte: in Hollywood in den Jahren des Studiosystems zwischen 1930 und 1950. Von der Künstlichkeit dieser Welten weiss Almodóvar so viel, dass er sie immer wieder zu Orten der wahren Empfindung machen kann.
Seine Position eines Vertreters des modernen europäischen Autorenfilms (und nicht des klassischen Hollywood) bringt es mit sich, dass er von Beginn an nach anderen sozialen Formen als denen der konventionellen Familie gesucht hat. In seinen Filmen ging es immer schon darum, die Wahl eines Lebensmenschen in Gruppenbildungen und Freundschaftsmodelle aufzulösen. Auch in sexueller Hinsicht geht es ihm nicht um die wahre Identität, sondern um die Verbindungen, die sich aus der Suche ergeben. Dabei lässt Almodóvar seine Figuren alles ausprobieren, was im weitesten Sinn bis zur Perversion (oder bis zu einem Missverständnis als Perversion) reichen kann: In «Kika» belebt eine Kosmetikerin eine Leiche wieder. Der frühe bis mittlere Pedro Almodóvar machte Filme, die schrill und bunt waren wie ein ewiges Kinderfernsehen, in dem sich die Neurosen der Grossen breitmachten. Er wird häufig als Stilist verehrt, als einer, der dem Autorenkino die Ästhetik zurückgegeben hat, der schwule Sensibilität für ein grosses Publikum zugänglich gemacht hat und die Hollywood-Tradition der «women’s pictures» in die Postmoderne überführte.
Seine reife Phase begann 1995 mit «La flor de mi secreto» mit der grossen Marisa Paredes. 1999 folgte «Todo sobre mi madre», einer seiner vielschichtigsten Filme, reich an filmhistorischen Bezügen und an Aspekten von «transición». Zu den grossen weiblichen Stars gibt es nicht selten, wie schon in «Tacones lejanos», ein Trans-Double oder eine zweite Identität. Almodóvar hielt vielen seiner Darstellerinnen die Treue, konzentrierte sich nun aber stärker auf deren individuelle Qualitäten, sodass er seither eine grosse Frauenrolle an die andere gereiht hat, mit einem Ensemble, das längst bis nach Amerika reicht, wo Penélope Cruz zum Weltstar wurde. In «Volver» spielte sie 2006 die Bewegung des Gesamtwerks von Pedro Almodóvar noch einmal ganz ernsthaft nach und durch: «Zurückkehren» ist das grosse Motto, zurückkehren in das Dorf, aus dem man kommt, zurückkehren in die Kindheit, die für immer prägt. An dem «jungen» Spanien, das er verkörpert, lässt sich besonders gut erkennen, wie eine Gesellschaft über einen Überschuss an Individualität und Libertinage hinweg neue, lebbare Traditionen schaffen kann. Es ist diese Bewegung, in der in schillernder Prägnanz deutlich wird, was es heisst, auf diesem Kontinent Europa zu leben, wo es alle Freiheiten gibt. Wir müssen nun lernen, sie zu verteidigen. Am besten mit den Mitteln, die Pedro Almodóvar vorschlägt: Kreativität, weibliche Solidarität, Anarchie, Gefühl, Überschwang und in allem eine enorme Intelligenz.
Bert Rebhandl, 1964 in Oberösterreich geboren, lebt als freier Journalist, Autor und Übersetzer in Berlin. Seine Webseite lautet: bro198.net.
 Heute
Heute