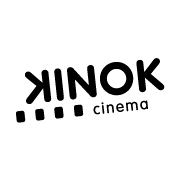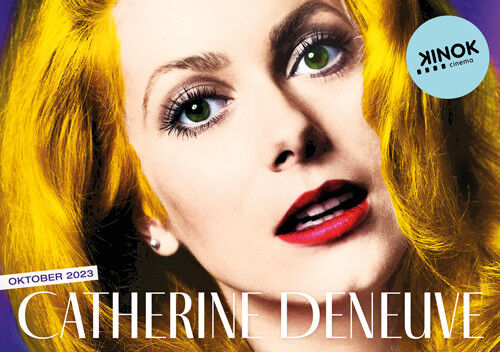
Catherine Deneuve
Komplizierte Unschuld und imperiale Robustheit
von Gerhard Midding
Irgendwann, der Film dauert schon eine ganze Weile, kommt der Moment, in dem die Diva und ihre Tochter einen kurzen Waffenstillstand schliessen. Sie sind es müde, zu streiten und einander zur Rechenschaft zu ziehen. Jetzt also stehen Fabienne (Catherine Deneuve) und Lumir (Juliette Binoche) am Fenster und blicken in den Garten hinaus. Sie setzen die Bestandsaufnahme ihrer Leben fort, nun aber gelöst, fast friedvoll. Sie tauschen Indiskretionen aus.
Lumir räumt schelmisch ein, dass ihr Mann ein besserer Liebhaber als Schauspieler ist. Ihre Mutter kontert, ihr jetziger Ehemann sei ein besserer Koch. Regisseur Hirokazu Koreeda filmt diesen Augenblick in «La Vérité» mit sichtlicher Genugtuung. Er hat Freude an dem schalkhaft abschätzigen Dialog, denn er lässt die Kontrahentinnen unverhofft zu Komplizinnen werden. Sie sind bereit, sich Gemeinsamkeiten zurückzuerobern. Fabienne ist überzeugt, dass zwei Qualitäten mehr sind, als man zum Leben braucht. Sie zog es vor, eine gute Schauspielerin zu werden und eine schlechte Mutter. Damit nahm sie in Kauf, dass das Publikum ihr verzeihen würde, die Tochter aber nie.
Selbstredend spielt Deneuve sich nicht selbst in «La Vérité». Vielmehr variiert sie die Mutterrollen, in denen sie bis dahin auftrat – am schönsten vielleicht in André Téchinés «Ma saison préférée», wo ihre leibliche Tochter Chiara Mastroianni an ihrer Seite steht. Dennoch steckt viel von Deneuve in dem Film. Sie verkörpert die Diva mit der ihr eigenen Ungezwungenheit als eine Bastion der Selbstgewissheit; ihr Urteil über die anderen kommt ohne den Filter der Höflichkeit oder Empathie aus. Man versteht sofort, weshalb die Franzosen ihre Leinwandlegenden monstres sacrés nennen! Natürlich besteht das Drehbuch darauf, dass die Festung erschüttert und vielleicht sogar eingenommen wird – aber ohne dass Fabienne dies als Eingeständnis der Schwäche empfinden muss, so viel Reverenz erweist Koreeda dem Mythos Deneuve.
Einst stand sie Modell für die Büste der Marianne, die in jedem französischen Rathaus steht. Catherine Deneuve als Symbol französischer Weiblichkeit auszuwählen, zeigte staatsmännische Umsicht: Deneuves Leinwandcharaktere stehen mit grosser Klarheit für sich selbst ein, treten mit einzigartiger, unwiderruflicher Bestimmtheit auf. Sie können ihren Wünschen selbstbewusst Geltung verschaffen. In der Rolle der Unterwürfigen kann man sich diese Schauspielerin schwerlich vorstellen. Zudem ist sie, nicht zuletzt dank ihrer langen, innigen Freundschaft mit Yves Saint Laurent, ein Inbegriff von Eleganz und Weltgewandtheit. Als Besitzerin einer Kautschukplantage in «Indochine» etwa verkörpert sie allein schon in ihrer Kostümierung – in jeder Szene trägt sie ein anderes Kleid – Glanz und Zwiespalt der Kolonialherrschaft. Es liegt etwas Gebieterisches in ihrem Spiel, eine gleichsam imperiale Robustheit. Deneuve ist eine Ikone des Kinos.
Ihren Durchbruch erlebt sie 1964 mit «Les Parapluies de Cherbourg» von Jacques Demy. Ihre Schönheit wird weltweit gerühmt. Aber Deneuve spürt schnell, dass sie dagegen anspielen muss. Ihre Züge sind unvergleichlich ebenmässig. Die Vollkommenheit jedoch ist etwas, was das Publikum eher bewundert als begehrt. Sehnsucht entsteht erst, wenn die Risse in der Fassade sichtbar werden. Also geht Deneuve schon früh Risiken ein. Den ersten Schritt unternimmt sie, als Roman Polanski ihr die Hauptrolle in «Repulsion» anbietet, der klinischen Studie einer inneren Zersetzung, einem neurotischen Schwanken zwischen Abscheu und Faszination. Polanski entdeckt, welche erotische Komplexität sich unter der Unschuld verbirgt, die in «Les Parapluies de Cherbourg» das Publikum bezauberte.
In «Belle de jour» geht Deneuve noch einen beherzten Schritt weiter. Die anscheinend glücklich verheiratete Arztfrau Séverine, die sie für Luis Buñuel verkörpert, verdingt sich in einem mondänen Bordell. Als die anderen Prostituierten vor einem merkwürdigen Kunden, einem Asiaten von massigem Wuchs und mit dubiosen Vorlieben, zurückschrecken, hat Séverine keine Skrupel. Unternehmungslustig lässt sie sich auf ihn ein; der rätselhafte Inhalt des Kästchens, das er ihr vor dem Liebesspiel zeigt, weckt ihre Neugierde. Die Szene am Morgen danach ist so fulminant, dass Deneuve noch Jahrzehnte später in jedem Interview zu ihr befragt wird. Das Bett ist zerwühlt, Séverines Kleidung ist über das ganze Zimmer verstreut und die Nachttischlampe wurde im Eifer des Gefechts umgestossen. Erschöpft liegt sie nun da. Das Zimmermädchen, das aufräumen will, ist bestürzt: Wie kann man nur mit einem solchen Mann ins Bett gehen? Aber Séverine antwortet ihr mit erhabener Verruchtheit: «Was verstehst du schon davon?»
«Belle de jour» ist ein Wendepunkt, der dem Rest ihrer Karriere die Richtung weist. Die vermeintlich unnahbare Schauspielerin in dieser schwefelhaften, verstörenden Rolle zu besetzen, ist nicht nur ein gelungener Coup des Regisseurs. Er besiegelt zugleich die Bereitschaft der Darstellerin, mit ihrem Image zu brechen. Fortan sucht sie immer neue Herausforderungen, wechselt zwischen Filmen für das grosse Publikum und anspruchsvollem Autorenkino, für das sie ihren Starruhm in die Waage legt. Für André Téchiné, mit dem sie die längste, intensivste Arbeitsbeziehung überhaupt verbindet, ist sie nicht nur eine zuverlässige Muse, sondern ein gleichwertiges Instrument der Reflexion.
Von «Les Parapluies de Cherbourg» an durchlebt Deneuve auf der Leinwand sämtliche Aggregatzustände der Liebe, von Verliebtheit und Umwerben bis zur Zurückweisung und zum Zorn. Ihre Filme erzählen von der Unbeständigkeit der Liebe, um deren Vielfalt gerecht zu werden. Sie ist eine schillernde Partnerin, darf wankelmütig und launisch sein im Namen der Ambivalenz. Sie ist ebenso intensiv in ihrer An- wie in ihrer Abwesenheit. Es ist essenziell für ihre romantische Leinwandpersona, dass ihre Figuren auch mal aus der Rolle fallen. Gern gestatten sie sich Augenblicke nonchalanter Anzüglichkeit: Anscheinend haben ihre Drehbuchautor:innen und Regisseur:innen «Belle de jour» immer im Hinterkopf.
Die liebenden Frauen, die sie verkörpert, changieren zwischen Ausgelassenheit und Schwermut. Zuneigung oder Verachtung sind bei ihr stets auch ein moralisches Urteil. Ihre Figuren stellen hohe Erwartungen an ihre Partner. Sie betrachten mit amüsierter Strenge, wie diese sich in der Welt behaupten. Mitunter ist es freilich auch deren Verletzbarkeit, die sie berührt und reizt. Deneuve ist wechselweise Gegenspielerin und Komplizin. Die Unschlüssigkeit des Theaterregisseurs in François Truffauts «Le Dernier métro», ob eine Liebesszene im Bühnenstück, das er einstudiert, nun als Duell oder als Komplott gespielt werden soll, beantworten ihre besten Filme mit einem entschiedenen sowohl als auch.
«Ma saison préférée» ist in dieser Hinsicht ein bemerkenswerter Solitär in ihrer Karriere, weil er von einer spannungsvollen, vielschichtigen Geschwisterbeziehung handelt. Daniel Auteuil spielt in Téchinés Familiendrama ihren entfremdeten Bruder, mit dem sie sich zusammenraufen muss, als ihre verwitwete Mutter pflegebedürftig wird. Es ist ein vielstimmiger Film, bei dem der Regisseur jedoch eine entscheidende Regel des französischen Starsystems beherzigt: Es beruht auf der Kombination. Auteuil und Deneuve spielen hier zum dritten Mal zusammen. (In Téchinés nächstem Film «Les Voleurs» treffen sie unter ganz anderen Vorzeichen aufeinander.)
Noch häufiger ist sie auf der Leinwand wohl nur noch Gérard Depardieu begegnet. Als François Ozon die Zwei in «Potiche» zusammenspannt, hat er gewiss ihren gemeinsamen Triumph in «Le Dernier métro» im Hinterkopf. Er spielt ja gern mit Kinomythen. Der Regisseur besetzt sie gleichsam als nationale Institutionen. Deneuve spielt die Gattin eines Industriellen, die nach dessen Herzinfarkt die Regenschirmfabrik (an Jacques Demy hat Ozon also ebenfalls gedacht!) erfolgreich weiterführt. Depardieu spielt ihren früheren Liebhaber (der vielleicht der Vater ihres Sohns ist), der bei einem Arbeitskampf in der Fabrik auf der Seite der Streikenden steht. Es wird noch komplizierter, als die stolze Matriarchin sich entscheidet, in die Politik zu gehen. Als Ozon sie nun mit maliziösem Vergnügen gegen den kommunistischen Bürgermeister Depardieu kandidieren lässt, führt er zwei widersprüchliche Impulse gegeneinander ins Rennen: eine sehr französische Sehnsucht nach Aristokratie und zugleich die Hoffnung auf eine Allianz zwischen dem proletarischen Helden und der Frau aus besserem Hause, die beide Stars zuvor schon oft eingegangen sind.
Die Kombination funktioniert in Ozons Komödie zwar prächtig, aber Deneuve dominiert sie dennoch souverän: mal kraft freundlicher Herablassung, mal mit argloser Frivolität, mal als muntere Demagogin. Deneuve hält wunderbar in der Ambivalenz, wo die Naivität ihrer Figur aufhört und ihr Kalkül beginnt. Ihre imperiale Selbstgewissheit jedenfalls ist unerschütterlich, ihre erotische und wirtschaftliche Unabhängigkeit erst recht. Domestizieren lässt sie sich nicht. So führt von «Le Dernier métro» bis zu «Potiche» eine Linie von Filmen, in denen Deneuve die alleinige Verantwortung für ein Unternehmen übernimmt. Dazu braucht sie die Männer nicht. Aber die Liebe muss sie deshalb längst nicht aufgeben.
Gerhard Midding ist freier Autor und Filmjournalist für Tageszeitungen (Berliner Zeitung, Die Welt), Zeitschriften (epd Film, Filmbulletin) sowie Radio (rbb Kulturradio) und Fernsehsender (3sat).
 Heute
Heute