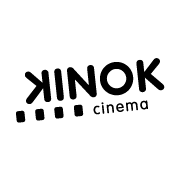Charlotte Gainsbourg – Lebende Legende
von Michèle Wannaz
Dieser traurige, seltsam entrückte Blick, dieser Trotz und dazu die staksige, leicht linkische Gangart – das macht die Mischung aus, der längst ganz Frankreich zu Füssen liegt. Charlotte Gainsbourg hat die Erwartung, dass bei diesem Genpool nichts anderes als ein dem Vermächtnis ihrer Eltern angemessener Kultstar heranwachsen könne, mehr als eingelöst. Und das will etwas heissen. Denn das Erbe lastet schwer: Vater ist der legendäre Chansonnier Serge Gainsbourg, Mutter die britische Schauspielerin Jane Birkin. Als die beiden sich kennenlernten, war er 40, längst National-Ikone, versoffen und verlebt, sie gerade mal 21, wunderschön und hauchzart. 1969 avancierten sie mit der Stöhn-Hymne «Je t’aime … moi non plus» zum Skandalpaar der Achtundsechziger-Ära, zwei Jahre später kam sozusagen die Frucht dieses Liedes – Charlotte – zur Welt. «Es ist wie ein Wunder, ihr ins Gesicht zu sehen», sagte einst Regisseur Bertrand Blier. «Da sind ihre Eltern, Jane und Serge, in diesem Gesicht. Was für eine Liebe müssen sie gelebt haben, diese beiden!» Charlotte selbst betont immer wieder, wie gerne sie das Aussehen ihrer Mutter geerbt hätte. Stattdessen bekam sie die Selbstzweifel ihres Vaters mit auf den Weg, der sich selber bekanntermassen schrecklich hässlich fand. «Mit solch einem Gesicht», singt er in einem seiner Lieder, «guter Gott! Das Einzige, was noch fehlt, sind Bommel an meinen Ohren!» Als Kind war Charlotte introvertiert und still. Sie litt darunter, in der Schule gehänselt zu werden, wenn ihr Vater im TV als Protest gegen seine Steuerrechnung wieder mal eine 500-Francs-Note verbrannt oder einer völlig sprachlosen Whitney Houston auf dem Sofa einer Talkshow «I want to fuck you» zugeraunt hatte. Auch wusste ganz Frankreich, dass er sich die Nächte mit Champagner, Pastis und Gitanes ohne Filter um die Ohren schlug, begleitet von Jane Birkin im Minikleid und einer Horde Boulevardfotografen. «Wir haben unsere Eltern nicht oft gesehen», sagt Charlotte über sich und ihre Schwester Kate, Jane Birkins Tochter aus erster Ehe. «Sie haben ihr eigenes Leben geführt. Wenn wir morgens aufstanden, um zur Schule zu gehen, kamen sie nach Hause. Wenn wir aus der Schule kamen, schliefen sie, und wenn wir zu Abend assen, standen sie auf.» Zwar erzählt sie von dieser Kindheit immer als einer glücklichen und bezeichnet die Beziehung ihrer Eltern als absolutes Ideal. Dennoch erbat sie sich mit zwölf, in ein Schweizer Internat gehen zu dürfen, fernab vom Dunstkreis des skandalträchtigen Paars. Auch heute wirkt Charlotte Gainsbourg noch schüchtern, beinahe zerbrechlich. Mit ihrem trotzig vorgeschobenen Kinn, der leisen, beinahe flüsternden Stimme und einem Lächeln, das immer etwas gequält wirkt, scheint es oft, als hätte sie sich in eine Traumwelt katapultiert, um den Zumutungen der Realität zu entfliehen. Gerade das aber macht ihren Charme aus – und sie immer wieder zur Projektionsfläche für Männerfantasien, einst sogar diejenigen des eigenen Vaters. Der drehte mit der damals Zwölfjährigen den Videoclip «Lemon Incest», in welchem sich die beiden auf einem Kingsize-Bett räkeln und von ihrem gegenseitigen Begehren singen, dessen Tabuisierung die Faszination füreinander nur noch steigere. Die Öffentlichkeit reagierte verstört. Gainsbourgs Status als Nationalheiliger wurde auf seine härteste Probe gestellt. Der Medienskandal schreckte den Provokateur aus Leidenschaft aber nicht ab, sondern regte ihn nur noch zum Nachdoppeln an: Drei Jahre später folgte «Charlotte for Ever» (1986), eine Art Ausdehnung des Clips auf Spielfilmlänge. Der Film wurde zwar ein Flop, doch Charlotte war als Objekt ihres sie vergötternden Vaters inzwischen selbst schon Ikone geworden.
Den eigentlichen Anstoss für die Schauspielerei hatte jedoch ihre Mutter gegeben. 1983 hörte sie, dass für ein Familiendrama ein junges Mädchen gesucht wurde, und hinterliess Charlotte eine Nachricht auf dem Küchentisch. Als sie nach Hause kam, waren Zettel und Kind verschwunden. Kurz darauf debütierte Charlotte in «Paroles et musique» (1984) als Tochter von Catherine Deneuve. Ein Jahr später, mit vierzehn, erhielt sie bereits den ersten César für ihre Rolle in «L’Effrontée» (1985). Und bald schon drehte sie beinahe in jeden Schulferien. Wohl nicht zuletzt durch die Eklats mit ihrem Vater bekam sie schnell einen Stempel aufgedrückt. In ihren ersten Filmen wurde sie beinahe durchgehend als erotische Kindfrau besetzt, die neugierig ihre erwachende Sexualität entdeckt. In «Il sole anche di notte» (1990) der Taviani-Brüder verführt sie einen Mönch, in «Merci la vie» (1991) lernt sie das HI-Virus fürchten, und in «The Cement Garden» (1993) ihres Onkels Andrew Birkin treibt sie ihren ebenfalls noch pubertierenden Bruder durch aufreizende Gesten beinahe in den Wahnsinn. Am Ende kommt es dann tatsächlich zum Inzest, der den ganzen Film über als dunkle Ahnung über dem Anti-Idyll schwebte, in dem vier Geschwister ihren je eigenen Umgang mit Trauer, Tod und Trauma suchen.
Es dauerte eine Weile, bis Gainsbourg das Image der rebellischen Lolita wieder abstreifen konnte. Entscheidend war dabei jedoch wieder ein Mann: ihr Lebenspartner, der Schauspieler und Regisseur Yvan Attal, den sie bereits 1991 beim Dreh von Eric Rochants «Aux yeux du monde» kennengelernt hatte, mit dem sie inzwischen seit 30 Jahren zusammenlebt und drei Kinder hat. Immer wieder standen die beiden gemeinsam vor der Kamera. Vor allem aber schrieb Attal ihr mit den ironischen Semi-Fiktionen «Ma femme est une actrice» (2001) und «Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants» (2004) Rollen auf den Leib, die Charlotte nicht nur ihr komisches Talent zeigen liessen, sondern auch ihr Image neu definierten. Mit einem Mal war sie nicht mehr das melancholische Nymphchen, sondern eine ganz normale erwachsene Frau – zwar immer noch voller Zweifel, doch auch voller Lebenslust und Tatendrang. Von da an wurde sie endlich auch für heiterere Rollen gecastet – ganz zu ihrer Freude. «Diese eindringlich-stillen, intimen Filme des französischen Kinos gehen mir eigentlich auf die Nerven», verriet sie in einem Interview. «Ich mag solche, die unverkrampfter und nicht so selbstsüchtig daherkommen.»
Immer wieder wurde sie – die dank ihrer Mutter akzentfrei Englisch spricht – auch in dieser Sprache besetzt, so 1996 etwa als Titelfigur in «Jane Eyre», 2003 neben Sean Penn in «21 Grams» oder 2007 an der Seite von Heath Ledger in der Bob-Dylan-Hommage «I’m Not There». Dadurch ergab sich mit der Zeit eine Sammlung an unterschiedlichsten Rollen und Filmen – und das Bild einer Frau, die sich nicht mehr so leicht schubladisieren lassen will.
Neben der Vorliebe für Beziehungskomödien blieb aber immer auch jene für eigenwillige Autorenfilmerinnen und -filmer bestehen und dominiert letztlich bis heute ihr Werk. So machte sie im letzten Jahrzehnt denn auch zunehmend durch eine wieder mutigere, sehr eigenwillige Rollenwahl von sich reden, die sogar an die Skandalträchtigkeit ihrer Anfänge anknüpft: Unter der Regie von Lars von Trier, dem einstigen Wunderkind des dänischen Dogma-Films, spielte sie zunächst in «Antichrist» (2009), einem Horror-Thriller über Sexualität, Schuld und Sadismus, dann im apokalyptischen Drama «Melancholia» (2011) und schliesslich im Zweiteiler «Nymphomaniac» (2013). Diese oft auch als «Trilogie der Depression» bezeichneten Filme wurden aufgrund ihrer zum Teil pornografischen und extrem gewalttätigen Darstellungen sowie dem grossen inhaltlichen Interpretationsspielraum äusserst kontrovers diskutiert. So nannte etwa Die Welt «Antichrist» den «meistgehassten Film» des Jahres 2009, und The Sunday Telegraph sprach sogar vom «schockierendsten Film in der Geschichte der Filmfestspiele Cannes». Ob Lars von Trier primär als schonungsloser Chronist menschlicher Grausamkeit zu werten ist, als pathologischer Selbstentblösser oder vielmehr einer, der um der Provokation Willen provoziert, darüber gehen die Meinungen nach wie vor auseinander.
In Interviews gibt er jedoch an, die drei Werke seien ein Versuch gewesen, eigene Ängste, Zwänge und Depressionen zu verarbeiten. Und der Zeit verriet er: «Meine Familie hatte sehr genaue Vorstellungen von Gut und Böse, von Kitsch und guter Kunst. Mit meiner Arbeit stelle ich all das in Frage. Ich provoziere nicht nur die anderen, ich erkläre mir, meiner Erziehung, meinen Werten, auch ständig selbst den Krieg. Und ich attackiere die Gutmenschen-Philosophie, die in meiner Familie herrschte.» In Charlotte Gainsbourg fand der Regisseur eine Schauspielerin, die sich nicht nur voller Intensität in ihre Rollen stürzte, sondern sich auch inhaltlich-formal mit ihm verbündete: «Heute ist alles so politisch korrekt. So langweilig. So vorhersehbar. Und alle haben solche Angst davor, was passieren wird, wenn sie mal zu weit gehen.»
Dass sie in von Trier eine Art Wiedergänger ihres ebenfalls alkoholkranken, notorisch die Öffentlichkeit provozierenden Vaters erkannt hat, mag zu weit gehen. Dennoch wirkt ihre Arbeit mit dem Skandalregisseur bisweilen wie ein Echo auf die Provokationen Serge Gainsbourgs, die dieser zumindest zum Teil auch als eine Art Waffe benutzte, um gegen eine Gesellschaft zu wüten, in der er – einst russisch-jüdisches Migrantenkind – sich nie willkommen gefühlt hatte.
Einen sanften biografischen Widerhall hat denn auch die Literatur-Verfilmung «La Promesse de l’aube» (2018), in der Charlotte Gainsbourg eine exzentrische russische Jüdin verkörpert – mal äusserst liebenswert, mal tyrannisches Muttermonster –, deren Wünsche von ihrem Sohn stets übereifrig erfüllt werden; ganz egal, ob er nun grad Kriegsheld werden soll, Diplomat oder Prix-Goncourt-Preisträger. Sowohl in der Vorlage – dem autobiografischen Roman des Schriftstellers Romain Gary, der in Frankreich längst Schullektüre ist – als auch im Film selber kreist alles um diese Mutter, die selbst in Abwesenheit allgegenwärtiges Zentrum bleibt. Denn auch wenn sich ihr Rollenfach mit dem Alter natürlich wandelt, gilt Charlotte Gainsbourg nach wie vor als lebende Legende des französischen Kinos. Und als solche prägt sie ganze Filme noch immer mehr als umgekehrt.
Dennoch bereut sie bis heute, nie eine Schauspielschule besucht zu haben: «Ich kann Szenen nicht analysieren. Ich weiss nicht, wo die Höhepunkte liegen. Manchmal denke ich, ich bin gar keine richtige Schauspielerin, ich spiele alles nur nach Instinkt und Gefühl.» Bleibt nur zu sagen: zum Glück!
Michèle Wannaz war viele Jahre als Filmjournalistin, Dramaturgin und Autorin tätig, heute lebt sie als Filmproduzentin in Zürich.
 Heute
Heute