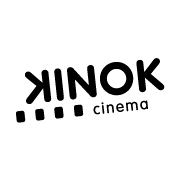Das Kino, ein Doppelagent der Überwachung
von Andreas Stock
Das Kino hat ein zwiespältiges Verhältnis zur Überwachung. Das hat einerseits mit dem Medium Film per se zu tun, das eines der Beobachtung ist und unsere Lust am Zuschauen befriedigt. Andererseits haben zahlreiche Filmschaffende sich auch kritisch mit Fragen der medialen Mechanismen und unserer Schaulust auseinandergesetzt. Populäre Beispiele dafür sind Alfred Hitchcock und Brian De Palma, die sich immer wieder mit dem Beobachten und den Folgen dieses Beobachtens beschäftigten. Der Blick der Kamera ist bei ihnen fast immer ein Blick des Begehrens. Es gibt kein neutrales Sehen. In den ersten Bildern von «Rear Window», in denen Hitchcocks Kamera in die Wohnungen blickt, die man vom Innenhof einsieht, ist erst der Zuschauer der Voyeur. Denn der von James Stewart gespielte Protagonist, der diese Rolle gleich einnimmt, schläft da noch.
Besonders in Kriegszeiten und während des Kalten Krieges wird die Überwachung der Gesellschaft sicherheitspolitisch legitimiert. Die Staatsraison wird fortwährend als Grund angeführt, wobei mittlerweile die Bedrohung durch den Terrorismus als Hauptmotiv zur flächendeckenden Kontrolle des Lebens herhalten muss. Filme spielen dabei die Rolle eines Doppelagenten: als mächtiges Instrument der Propaganda, aber ebenso als ein Medium der Aufklärung und Warnung. Filmgeschichtlich veränderten politische Umbrüche und der technologische Fortschritt den Blick auf die Überwachung nachhaltig. Zwar war das Thriller-Genre schon früh von Geschichten geprägt, die von Lug und Trug in der Welt handeln, in der Angst und Pessimismus herrschen. Zum Beispiel in den allegorischen Verbrecherfilmen um Dr. Mabuse von Fritz Lang («Dr. Mabuse, der Spieler», 1922). Und George Orwell entwarf mit «1984» bereits 1949 seine düstere Vision eines aggressiv-invasiven Systems, in dem es eine vollständige Kontrolle aller Bürger gibt und das Individuum seiner Privatheit beraubt ist. Ein Szenario, das in den USA spätestens nach dem 11. September 2001 mit dem «Patriot Act» Realität wurde, jenem Bundesgesetz, das im Oktober 2001 vom US-Kongress beschlossen und von weiten Teilen der Gesellschaft begrüsst wurde.
Zwar wurde die Überwachung in den USA bereits zu Zeiten des Kalten Kriegs kaum als Bedrohung oder Beschränkung, sondern vielmehr als Massnahme zur Erhöhung der Sicherheit wahrgenommen. Doch dann folgten der Vietnam-Krieg, die Verschwörungstheorien um das Attentat an Präsident John F. Kennedy und die Watergate-Affäre. Damit verloren die eigenen Institutionen gesellschaftlich an Glaubwürdigkeit. Dies löste in den Siebzigerjahren in den USA eine Welle von konspirativen Filmen aus; man nennt diese Periode des US-Kinos das «Goldene Zeitalter der Paranoia». Dazu zählen unter anderem Alan J. Pakulas sogenannte Paranoia-Trilogie mit «Klute» (1971), «The Parallax View» (1974) und «All the President’s Men» (1976) oder der Spionagethriller «Three Days of the Condor» (1975) von Sidney Pollack, in dem sich Robert Redford als unbescholtener CIA-Mitarbeiter plötzlich mit der lebensbedrohlichen Bürokratie innerhalb der CIA konfrontiert sieht.
Das Verschwörungs- und Paranoiakino jener Zeit wurde auch damit befeuert, dass die Methoden der Überwachung systematischer, unauffälliger und anonymer wurden. Einen der herausragenden und weitsichtigsten Filme jener Zeit schuf Francis Ford Coppola mit «The Conversation» (1974), dem Klassiker des Überwachungsfilms überhaupt. Harry Caul (Gene Hackman), ein Meister der Abhörmethoden und ein paranoider Mann, wird sich am Ende bewusst, dass auch er abgehört wird. Auf der verzweifelten Suche nach der Wanze demontiert er seine Wohnung komplett. Überwachung ist in «The Conversation» nicht nur das inhaltliche Thema, sondern Coppola und sein Ton- und Schnittmeister Walter Murch setzen deren Methoden auch konsequent in ihrer Inszenierung ein.
Die Abhör- und Überwachungsmethoden, die Harry Caul oder der Stasi-Beamte Gerd Wiesler (Ulrich Mühe) im DDR-Drama «Das Leben der Anderen» anwenden, muten im Vergleich zu heutigen Methoden geradezu archaisch an. Dies gilt auch für die Schweizer Bundespolizei in den Neunzigerjahren, die in der Fichenaffäre zwischen 1900 und 1990 rund 700’000 Personen ohne gesetzliche Grundlage bespitzelte. Das bedeutete, dass sich Tausende an die Fersen von «Zielpersonen» hefteten und minutiös notierten, was sie sehen und hören konnten. Während Gerd Wiesler erkennen muss, dass seine Kontrolle von Bürgern nicht allein der Sicherheit des Staates dient, handelt der Dokumentarfilm «Gasser & Gasser» von Iwan Schumacher von einem Zürcher Staatsschutzbeamten, der ob der Fichenaffäre in eine Lebenskrise gerät und schliesslich Selbstmord begeht.
Angesichts der Menge an Daten, die heute täglich über uns zusammengetragen werden, erscheint die Überwachung während der Fichen-Ära nahezu unbedeutend. Die rasante technologische Entwicklung und die Digitalisierung haben die Überwachung revolutioniert – und den «Faktor Mensch» minimiert. Heute überwacht uns ununterbrochen ein Gerät, das wir alle freiwillig mit uns herumtragen und das Konzerne wie Google oder Apple mit Informationen aus unserem Privatleben versorgt. Spätestens seit den Veröffentlichungen über die Machenschaften der Geheimdienste durch Edward Snowden ist klar, wie sehr wir zu gläsernen Menschen geworden sind. Erregte die Fichenaffäre damals die Schweizer Bevölkerung noch heftig, blieb der Sturm der Entrüstung über die Snowden-Beweise weitgehend aus. Viele reagierten mit einem Schulterzucken auf die Ungeheuerlichkeit, wie einfach es ist, in unsere Privatsphäre einzudringen. «Es interessiert doch niemanden, was ich tue» und «Ich habe nichts zu verbergen» sind zwei der fatalen Aussagen, mit denen der im Internet frei zugängliche Dokumentarfilm «Nothing to Hide» (2017) die Haltung einer Mehrheit aufzeigt. Snowden entgegnete in einem Interview: «Zu sagen, man habe nichts zu verbergen und deshalb sei einem die Überwachung egal, ist das gleiche wie zu sagen, dass einem das Recht auf Redefreiheit egal sei, weil man nichts zu sagen habe». Es sei hoch «undemokratisch» und trügerisch, sich allein auf die Gesetze demokratischer Ordnungen zu verlassen, denn diese haben ihre Labilität immer wieder bewiesen. Wie der Dokumentarfilm «Im inneren Kreis» (2017) aufdeckt, werden selbst innerhalb einer Demokratie Menschen allein wegen ihrer Gesinnung überwacht. Der Film zeigt, wie in der linken Szene Hamburgs jahrelang verdeckte Ermittlerinnen und Ermittler aktiv waren.
Die technologische Entwicklung macht zudem nicht halt. Mit dem Argument der Sicherheit werden immer dichtere Kontrollnetze gewoben, werden Freiheiten und Privatsphäre immer weniger geschützt. In China tragen Polizisten Hightech-Sonnenbrillen, die mit Kameras ausgestattet sind und über Gesichtserkennung «Verdächtige» in der Masse ausfindig machen – innert Sekunden. Auch Schweizer Polizeikorps sollen über sogenannte Imsi-Catcher verfügen, mit denen sich im Umkreis von mehreren hundert Metern der Datenverkehr sämtlicher Handys abgreifen lässt – zum Beispiel von Teilnehmern einer Demonstration. Der Dokumentarfilm «Pre-Crime» führt vor Augen, wie mittels Algorithmen und Datenabgleichen sogar mögliche kriminelle Taten vorherzusagen sein sollen – mit zwiespältigen Folgen. Die Regisseure Monika Hielscher und Matthias Heeder inszenieren dies unter anderem mit den Stilmitteln des modernen Genrekinos, indem sie Bilder von Überwachungskameras einsetzen oder simulieren. Das führt wieder zur janusköpfigen Seite des Kinos, das ab den 1990er-Jahren beginnt, die stetig wachsende Zahl von Überwachungskameras zu thematisieren. Die «Echtzeit» von Überwachungskameras, im Unterschied zu den Überwachungskameras mit Videobändern, wird nun auch erzähldramaturgisch genutzt, zum Beispiel in «Enemy of the State» (1998) von Tony Scott, der als zeitgemässes Remake von «The Conversation» gesehen werden kann und in dem erneut Gene Hackman mitspielt. Neben seiner Kritik an der Allmacht von Überwachung erliegt Scott allerdings der Faszination der Technologie, die er als visuelles Spektakel inszeniert. Anders die britische Regisseurin Andrea Arnold in ihrem Kinodebüt «Red Road» (2006): Ihr Drama dreht sich um eine Beamtin in einer Überwachungszentrale in Glasgow, die ihre Möglichkeiten der Überwachung für eigene Interessen zu missbrauchen beginnt.
Was die Fichenaffäre mit unserer Gegenwart verbindet, ist Gegenstand des Theaterstücks «Lugano Paradiso», das Andreas Sauter für das Theater St.Gallen geschrieben hat und das von Ende März bis Anfang Juni in der Lokremise zu sehen ist. Regisseur Jonas Knecht erweitert für das Stück den Aufführungsrahmen: Neben dem Theatersaal spielt sich ein Teil der Inszenierung in der Ausstellung «Protection» von Bettina Pousttchi in der Kunstzone ab und ein weiterer im Kinosaal.
Andreas Stock schreibt seit rund 30 Jahren über Film, bis 2017 vor allem für das «St.Galler Tagblatt». Das Genrekino faszinierte ihn schon immer, besonders wenn es Filmschaffenden gelingt, die Genre-Konventionen zu erweitern oder aufzubrechen.
 Heute
Heute