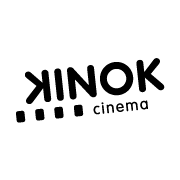«Anna Karenina» durch drei Epochen der Filmgeschichte
Zeitweise allzu russisch, dann auch weniger
von Pierre Lachat
Zweimal binnen acht Jahren ein und dieselbe Rolle zu spielen – in «Love» und dann wieder in «Anna Karenina» – war für Greta Garbo keine Selbstverständlichkeit. Doch hatte die Wiederaufnahme des Stoffes mit der nämlichen Besetzung gute Gründe, da der erste der beiden Filme 1927 noch stumm entstanden war, der zweite 1935 mit Ton. Bis dahin hat sich erwiesen, dass die geborene Gustafsson, über Berlin nach Hollywood gelangt, eine unabdingbare Voraussetzung mitbringt, um vor die Mikrofone zu treten, nämlich eine immerhin passable, sogar passende Stimme. Viele Kollegen, die nur stumm gespielt haben, bleiben beim überstürzten Wechsel zur neuen Technik auf der Strecke und sind bald vergessen.
1935 – Der Fluch des Gelingens
«Anna Karenina», das Remake, führt vor Ohr und Auge, dass Greta Garbos Kehle wohl geeignet ist, wenn auch keine entscheidende Stärke. Eher schon steckt ihr Bestes in der Bedeutung jenes spanischen Künstlernamens, der so viel wie Anmut heissen will. Blick, Gesicht, Haltung, Geste, Gehabe, auch der spürbare Abstand zum Publikum prägen sie: jenes Mysterium, das sich so deutlich allem Ranschmeissen und Beifallheischen verweigert. Daraus ist zu schliessen, dass die Sphinx, die Greta Garbo nach aussen hin darstellt, innerlich ihrer Neigung zur Wortlosigkeit aus den Jahren der stummen Leinwand treu geblieben ist, bis hin zu den dialogreichen Komödien, in denen sie auch noch spielen sollte.
So oft und so ergeben scheint sie zu leiden, doch ohne je zu jammern. Stattdessen springt sie am Ende von «Anna Karenina», russisch depressiv und vom Diesseits enttäuscht, vor den heranrollenden Zug. In einem gewissen Sinn wird die Episode einen prophetischen Charakter gewinnen, da die Mimin, des Rummels müde, aber wohl auch der Wiederholungen, nur sechs Jahre danach die Schauspielerei aufgibt, um fortan der Öffentlichkeit fernzubleiben. An-, dann abwesend, wächst sie sich vollends zum Geheimnis aus und flüchtet ins nur noch schwer Verständliche. Bei mangelndem Mass wird das Gelingen auch einmal zum Fluch: ähnlich, wie ein Zuviel der ohnmächtigen Liebe Anna Karenina verzweifeln lässt. Übertrumpfen sich die Erfolgreichen selbst, ist Vorsicht geboten.
1997 – Das verheissene Land
Um 1870 wird Leo Tolstoi Zeuge eines Vorfalls, der ihn dazu bewegt, «Anna Karenina» zu verfassen. Die Geliebte eines seiner Nachbarn erfährt von der Untreue ihres Liebhabers und wirft sich vor die Räder. Der Roman löst im neuen Jahrhundert, von 1911 an, eine lange Reihe von Adaptionen aus. Ob in der Form einzelner Arbeiten oder als Serien, der Stoff bietet viel Spielraum für Nebenhandlungen, er besticht aber vorab durch die Sinnfälligkeit des zentralen Konflikts, der sich leicht in einen Satz fassen lässt. Es ist anzunehmen, es habe wohl jenen einen realen Hergang und Anstoss gebraucht, damit die Intrige dem Romancier so beispielhaft geraten konnte, wie sie sich noch heute ausnimmt.
Wo Greta Garbo in der An- die Abwesenheit findet und umgekehrt, da bringt die Rolle der Anna Karenina für jemanden wie Sophie Marceau wenig anderes mit sich als einen Part unter anderen. Es gilt ihn zu bewältigen, auf beiden Beinen und mit irdischer Standhaftigkeit. Keinesfalls kommt es in Frage, jene sagenhafte Schwedin zu imitieren. Dabei wäre es leicht gewesen, an die Entrückte vom Sunset Boulevard wenigstens zu erinnern. Der agilen Französin gelingt die heikle Aufgabe leidlich, auch dank eingestreuter russischer Sprachfetzen und der verfeinerten Verfahren beim Synchronisieren der Stimmen.
In über sechzig Jahren, bis 1997, haben sich die Zeiten geändert. Aktuell ist alles demonstrativ Russische gefragt, nunmehr in Farbe gedreht, auch an Ort und Stelle, und durchzogen von einer Sehnsucht nach dem Zarismus und Feudalismus von ehedem. Eben hat sich die Diktatur der Sowjets erübrigt und damit eine Eingliederung des verheissenen Landes in eine Weltmacht Europa denkbar werden lassen. Allerdings ist dann das Regime Putin dazwischen getreten, und es hat die aus- und übergreifenden Pläne des Westens vereitelt. Mitsamt historischem Drum und Dran bleibt alles Russische vorerst, was es ist.
2012 – Die schrumpfenden Weiten
Die politischen Illusionen der Neunzigerjahre sind verflogen. In England verrutscht das anschaulich Russische aus der fünfzehn Jahre älteren Fassung hinüber in eine wieder mehr literarische Interpretation. Wiewohl von Beengung und leichter Atemnot beeinträchtigt, rückt zumal Keira Knightleys perfekte Londoner Theaterdiktion ganz ohne Korrekturen alles, was da noch exotisch aussehen möchte, wieder zurück in ihre Sprache und damit, mehr noch, in Dimensionen und nach fiktiven Örtlichkeiten der Shakespeare’schen Art.
Von Greta Garbos anmutiger Verschlossenheit bringt die Hauptdarstellerin eher wieder etwas vor die Kamera, sicher das leicht Ätherische, ja Flüchtige. Doch tut sie es, wie vor ihr Sophie Marceau, ohne eigentlich nachahmen zu wollen und damit falsche Vergleiche auf sich zu ziehen. Die Schwedin aus Hollywood hatte sich schmählich verabsentiert, und bis heute scheint kaum jemand willens oder fähig zu einer glaubwürdigen Reinkarnation jener Diva.
Selbst über Vor- und Abspann schieben sich bewegliche Schatten. Ein Vorhang geht auf und gibt Szenenbilder frei mit lauter Oper, Walzerklängen, Kostümen, Tänzen, Bällen, Ballett und mit falschem Feuerwerk. Was da so inszeniert daherkommt, ist die Selbstinszenierung der Herrschenden, ihr Leben im Schauspiel. Bis hin zur Bahnhofshalle und zu einer Pferderennbahn wirken viele Schauplätze, als wären sie auf die Bretter verfrachtet oder der Fantasie der Protagonisten entnommen. Die Weiten Russlands sind hoffnungslos geschrumpft, auch die Sonne bleicht aus. Der Schnee liegt nur vereinzelt, erkennbar hingeschaufelt. Eher schon rieselt er, getrickst, vom hohen Dach auf die Sitzreihen herab. Die ganze Welt sei halt eine Bühne, muss das Klischee lauten, an dem es hier kein Vorbeikommen gibt. Aber ein Gleiches hat für jedermanns ganzen Kopf zu gelten.
Pierre Lachat ist seit 50 Jahren als Journalist in Presse, Radio und Fernsehen, seit 25 Jahren als Dozent für Filmgeschichte tätig.
In der Lokremise kommt im September das Stück «Anna Karenina» von Armin Petras zur Aufführung. Informationen und Spieldaten finden Sie auf der Theaterseite .
 Heute
Heute