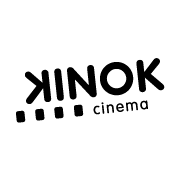Good Vibrations
Zu den Filmen von Claire Denis
von Michael Omasta
Claire Denis setzt weder auf Digitaltricks noch dröhnende Sounddesigns, und dennoch können ihre Filme einen ganzen Kinosaal zum Vibrieren bringen. Ich selbst habe dies zum ersten Mal vor bald 20 Jahren bei «Nénette et Boni» verspürt, einem Film, in dem die Kamera mitunter so nahe an die Darsteller herangeht, wie man sich das im Alltag als wohlerzogener Europäer niemals erlauben würde.
Noch stärker war dieses Vibrieren, als ein Arthouse-Kino in Wien vor ein paar Jahren eine Vorstellung von «Trouble Every Day» aufs Programm setzte. Anders als in der Frühzeit der Kinematografie, als man gewissen Filmen noch den Hinweis voranstellte, Menschen mit schwacher Konstitution sollten den Saal lieber verlassen, gab es damals keine Warnung – dafür gab es während der Vorführung dann allen Ernstes sogar einen Ohnmachtsanfall.
Die Filme von Claire Denis lassen einen nicht kalt, sie erzählen von Anziehung und Abstossung, von Einsamkeit und dem Wunsch nach Zugehörigkeit, von überraschend zärtlichen Männern und unabhängigen, gelegentlich auch wilden Frauen. Sie berühren, allerdings nicht im sentimentalen Sinn, sondern als sinnliche Erfahrung. Es gibt nicht viele Regisseure – und gewiss noch viel weniger Regisseurinnen –, von deren Werk sich das behaupten lässt. Doch bei aller Wertschätzung zählt Denis bis heute zu den Aussenseiterinnen des internationalen Kinobetriebs. Entsprechend rar sind die Gelegenheiten, ihre Arbeiten einmal auf grosser Leinwand zu sehen.
Denis, 1948 in Paris geboren, wuchs als Tochter eines Kolonialbeamten im damaligen Französisch-Westafrika auf; als sie schwerkrank mit 14 Jahren nach Frankreich kam, muss sie sich unendlich fremd gefühlt haben. Immer wieder kehrt sie in ihren Filmen nach Afrika zurück. In ihrem in Kamerun angesiedelten, sanft autobiografisch getönten Spielfilmdebüt «Chocolat» (1988) erzählt sie die Geschichte eines kleinen Mädchens namens France, ihrer Mutter und des schwarzen Hausangestellten, unter dessen Obhut sie erwachsen wird. Oder zuletzt, in «White Material» (2009), hält Isabelle Huppert in der Rolle der unerschütterlich eigensinnigen Kaffeeplantagenbesitzerin Maria quasi als letzte Weisse die Stellung in einem zunehmend vom Bürgerkrieg verwüsteten afrikanischen Land.
Afrika, genauer Djibouti, ist auch Schauplatz ihres bekanntesten Films. «Beau travail» (1999) wurde zum Triumph bei der internationalen Kritik. Ein virtuos choreografierter Rückblick auf das Leben des Feldwebels Galoup (Denis Lavant) in der Fremdenlegion, der leise mit dem Chor «Unter der brennenden Sonne Afrikas» beginnt und mit einem einsamen, ekstatischen Tanz zum «Rhythm of the Night» schliesst. Dazwischen die Erinnerungen an ein Soldatenleben: an Disziplin und unerfülltes Begehren, gefrorene Posen und bewegte Körper, militärisches Pathos und Oriental-Pop, weisse Sonne und blaues Meer.
«Meine Geschichte», meint Galoup zu Beginn, «ist simpel.» Doch der Film, und wie er gemacht ist, sind es nicht. Ein rigoroser Montagerhythmus strukturiert das Ballett der sinnlos gewordenen Trainingseinheiten und Rituale, denen die Männer in der Legion nachkommen. Ähnlich einem griechischen Chor führt Denis eine Gruppe afrikanischer Frauen ein, die wortlos, bisweilen amüsiert, diese hermetische Welt betrachten und so deren zwanghaften Charakter deutlich machen.
Doch zurück zur Regisseurin, die nach ihrem Studium an der Pariser Filmhochschule IDHEC anderthalb Jahrzehnte lang als Assistentin der grössten Cineasten unserer Zeit arbeitete: unter ihnen Jacques Rivette, Andrei Tarkowski, Dušan Makavejev, Jim Jarmusch, Wim Wenders. Sogar Robert Bresson lernte Denis kennen, indem sie sich bei «Quatre nuits d’un rêveur» als Statistin meldete: «Ich sah Bresson zu, wie er arbeitete: sehr langsam, ganz präzise. Aber natürlich lernt man nichts dabei – man bewundert nur.»
Was ihr eigenes Schaffen betrifft, so gibt es bei Denis keine erkennbare Hierarchie zwischen den Genres, auch nicht zwischen Kurzfilmen und langen Arbeiten. Schon ihr bereits erwähntes Regiedebüt gab auch den Anstoss zu ihrem ersten Dokumentarfilm «Man No Run» (1989) über eine Frankreich-Tournee der punkigen Rhythmusgruppe Têtes Brûlées aus Kamerun. Im Jahr darauf widmete Denis ihrem früheren Arbeitgeber Rivette die TV-Dokumentation «Jacques Rivette: Le Veilleur» (mit dem Kritiker Serge Daney als Interviewer) und mit «Vers Mathilde» schuf sie 2005 ein intensives Porträt der Choreografin und Tänzerin Mathilde Monnier.
Schon allein diese drei dokumentarischen Arbeiten zeugen von den weitgesteckten Interessen der Regisseurin. Dazu kommen noch die verschiedensten literarischen wie theoretischen Texte, die ihr als Inspiration gedient haben: darunter Bücher von Herman Melville («Beau travail»), Emmanuèle Bernheim («Vendredi soir», 2002), Jean-Luc Nancy («L’intrus», 2004) und Doris Lessing («White Material»). Doch je genauer man auf diese Filme, ihre Charaktere oder die Handlung schaut, desto stärker scheinen sie sich einem auch entziehen zu wollen. Filme zu «verstehen» ist für Denis vorrangig nicht Sache des Kopfes, sondern vielmehr des Herzens – oder manchmal, wie im Fall ihres unheimlichen Meisterwerks «Trouble Every Day» (2001), auch der Eingeweide.
Das gilt selbst dann, wenn Claire Denis wie in «35 rhums» (2008) ungewohnt sanfte Töne anschlägt: eine Hommage an einen Klassiker des japanischen Kinos, namentlich Yasujiro Ozu und dessen «Banshun» (Spätfrühling), in dem ein Witwer beschliesst, erneut zu heiraten, um seine längst erwachsene Tochter endlich ins eigene Leben hinauszustossen. Da wie dort ist jegliche Dramatik zwischen die Bilder verbannt, das Geheimrezept für Ozus wie Denis’ präzis stilisierte Art des filmischen Erzählens lautet: Ellipse. Einmal kommt Vater Lionel mit einem Päckchen für seine Tochter Joséphine nach Hause; die Inbetriebnahme des neuen Reiskochers ist der emotionale Höhepunkt von «35 rhums».
Alex Descas und Mati Diop spielen Vater und Tochter, in einer weiteren Hauptrolle ist Grégoire Colin zu sehen. Alle drei sind sie Mitglieder jener grossen Ensemblefamilie, die Claire Denis bei der Arbeit um sich zu scharen pflegt und zu deren wichtigsten Angehörigen neben Isaach De Bankolé, Béatrice Dalle, Vincent Gallo, Alice Houri und Michel Subor noch die grandiose Kamerafrau Agnès Godard, der Drehbuchautor Jean-Pol Fargeau, die Schnittmeisterin Nelly Quettier sowie Komponist Dickon Hinchliffe und die britische Band Tindersticks zählen. Sie alle haben massgeblichen Anteil am charakteristischen Look und dem schier unverwechselbaren Sound ihrer Filme.
Gleichwohl schafft es Denis bis heute, mit jeder neuen Arbeit zu überraschen. Zuletzt mit «Les salauds» (2013), einem tiefschwarzen, über weite Teile mindestens so intimen wie sperrigen Kammerspiel mit Vincent Lindon und Chiara Mastroianni. Es ist ihr erster digital gedrehter Spielfilm, und er bestätigt auf das Schönste, was der Berliner Filmemacher Christian Petzold, als ich ihn nach seinen Lieblingsregisseuren befragte, einmal über Claire Denis gesagt hat: «Sie filmt etwas, das bisher nicht gefilmt worden ist. Etwas, das neben dem Körper liegt, wie Wärmeabstrahlungen.» Das alte Vibrieren ist noch da.
Michael Omasta ist Filmredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter. Er kuratiert Filmreihen, forscht zum Thema österreichisches Filmexil und hat als Mitbegründer der Buchreihe FilmmuseumSynemaPublikationen unter anderem den Band «Claire Denis. Trouble Every Day» (gemeinsam mit Isabella Reicher) herausgegeben.
 Heute
Heute