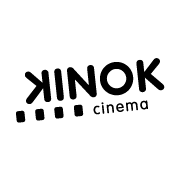Tierfilme, Filmtiere
von Christoph Egger
Ist der «Tierfilm» nun ein «Genre»? Sinnvoller wäre wohl zu sagen, dass er sich in jedem Genre manifestieren kann, insgesamt ein riesiges, schon längst nicht mehr überblickbares Korpus bildend. Wir finden ihn im Dokumentarfilm so gut wie im Animationsfilm, im Werbefilm oder im Spielfilm – und dort ebenso als Kinder- wie als Action- oder Horrorfilm. So gründet der Animationsfilm ebenso wie etwa der Horrorfilm mit seiner Vielzahl von zoomorphen Gestalten besonders in seiner Frühzeit wesentlich auf Tierfiguren. Geradezu zum Synonym dafür ist der Name Disney geworden, der aber auch mit seinen aus heutiger Sicht dubiosen Tierdokumentationen – den True-Life Adventures wie «The Living Desert» (Die Wüste lebt, 1953) oder «The Vanishing Prairie» (Wunder der Prärie, 1954) – die Dramaturgie der Tierdarstellung im Mainstream auf Jahrzehnte hinaus prägen sollte.
Haben wir es mit einem Tierfilm oder bloss mit Filmtieren zu tun? Ein Tierfilm im strikten Sinn des Wortes würde den Menschen ganz aus dem Bild ausschliessen – wie zumal in den (Fernseh-)Tierdokumentationen – oder doch stark marginalisieren. Im Spielfilm müsste dann der Name des Tiers auch den Filmtitel abgeben wie bei Lassie und Flicka (die beide «Mädchen» bedeuten), bei Flipper (die Brustflosse), dem Grossen Tümmler, oder Namu und Willy, den Schwertwalen (in «Namu, the Killer Whale», 1966, und der «Free Willy»-Trilogie, 1993–97). Das reizende Tierkinderidyll «Miez und Mops» (Koneko monogatari, 1986) von Masanori Hata bringt Kätzchen und Hündchen (und eine Menge weiterer Tiere) zusammen – und ist ganz auf Identifikation des Publikums mit den tierischen Helden angelegt.
Häufig erleben wir, dass die tierischen Darsteller keineswegs schon im Filmtitel erscheinen müssen, um uns im Gedächtnis zu bleiben. Ja sie brauchen nicht einmal einen Namen zu haben und können doch handelnde Persönlichkeiten sein wie Elliott Goulds Katze in Robert Altmans «The Long Goodbye» (1973) oder Oscar Isaacs red tabby cat in «Inside Llewyn Davis» (2013), dem jüngsten Film der Coen-Brüder. Art Carneys Tonto hingegen hat es zum Titelhelden gebracht in «Harry and Tonto» (1974), Paul Mazurskys quer durch Amerika führendem Roadmovie. Das in zahllosen Nebenrollen im Spielfilm am weitesten verbreitete Tier dürfte aber der Hund sein. Seine Ahnenreihe beginnt mit Stummfilmstars, kennt Serienhelden wie Lassie oder Mrs. Asta, der smarte Drahthaar-Foxterrier an der Seite von William Powell und Myrna Loy in W. S. Van Dykes Umsetzungen von Dashiell Hammetts «The Thin Man» (1934–41). Auch in Japan sind «Hundefilme» ausgesprochen populär. Zwar in die USA transponiert, aber nach historischem japanischem Vorbild und mit einem echten Akita-Hund in der Hauptrolle neben Richard Gere, erzählt Lasse Hallströms «Hachi: A Dog’s Tale» (2009) die wahre Geschichte Hachikos nach, der seinem Herrchen weit über dessen Tod hinaus treu bleibt. Und wenn in Frank Marshalls «Eight Below» (2006) zwar nur die Hundedarsteller überzeugen, so erinnert das Remake immerhin an den eindringlichen «Nankyoku monogatari» (1983), die «Südpol-Erzählung», von Koreyoshi Kurahara, der vom Schicksal eines Hundegespanns in der Südpolarnacht handelt, das von einer japanischen Antarktisexpedition zurückgelassen werden musste. In der tragischen Variante ist es der geplante Tod des Hündchens in Cesare Zavattinis und Vittorio De Sicas neorealistischem Meisterwerk «Umberto D.» (1952), der die entsetzliche Verlorenheit der Titelfigur in einem mitleidlosen Nachkriegsitalien besiegelt. Kein Film aber hat es wie «State of Dogs» (1998) unternommen, gleichsam die Essenz des Hundseins zu ergründen. In meisterhafter Inszenierung erzählen der belgische Dokumentarfilmer Peter Brosens und sein mongolischer Kollege Dorjkhandyn Turmunkh die Legende von Baasar, der wie so viele seiner streunenden Art- und Leidensgenossen aus Ulaanbaatar erschossen wurde und nun unschlüssig ist, ob er eine Reinkarnation will. Schöpfungsmythos und erbärmlichste Realität, wilde Gedichtrezitationen und Naturschauspiel, das in einer tatsächlichen Sonnenfinsternis gipfelt, koagulieren zu geradezu surrealistischen Bildarrangements.
Nutztiere im Familienfilm kennen ihre Bestimmung nur noch als dunkel erinnertes Verhängnis. So «Rennschwein Rudi Rüssel» von Peter Timm nach Uwe Timm, so «Babe» aus der im selben Jahr 1995 entstandenen, bezaubernden australischen Produktion unter der Regie von Chris Noonan. Drehbuchautor und Produzent George «Mad Max» Miller realisierte in der Folge das künstlerisch und psychologisch womöglich noch subtilere Sequel «Babe: Pig in the City» (1998). In diesen Filmen traten neben menschlichen Darstellern sowohl reale Tiere wie auch – vor dem Siegeszug des digitalen Kinos, das Miller später zu seinen Pinguin-Epen «Happy Feet» (2006, 2011) nutzte – gekonnt eingesetzte animatronische «Doubles» auf. Während Robert Bresson in «Au hasard Balthazar» (1966) die Passion eines Esels als Gleichnis für christliche Existenz erzählt, immerhin mit einem lichten Ausblick, kommt die Erlösung in «Die Geschichte vom weinenden Kamel» (2003) von Byambasuren Davaa über die heilende Kraft der Musik, die eine mongolische Kamelstute ihr dem Hungertod nahes Fohlen in einer berührenden Szene endlich annehmen lässt.
Neben Hunden sind zweifellos Pferde die häufigsten Filmtiere, wobei sie hier weniger als Nutztier, etwa als Ackergaul, denn als Arbeitstier erscheinen wie in den unzähligen Western. Beliebt sind Spring- und Rennpferde; künstlerisch wenig anspruchsvoll etwa in «Seabiscuit» (2003) von Gary Ross, einer «wahren Geschichte» um zwei- und vierbeinige Benachteiligte in der Zeit der grossen Depression, berückend in Carroll Ballards «The Black Stallion» (1979) nach Walter Farleys Jugendbuch, wo Tier und Bub zu Evokationen einer ursprünglichen Wildheit finden, die wiederum an Albert Lamorisses in leuchtendes Schwarzweiss getauchte Camargue-Saga «Crin-Blanc» (1953) gemahnt. Wie auch immer geschönt, erinnert Steven Spielbergs «War Horse» (2011) immerhin an das Schicksal der zu Kriegsdiensten eingezogenen Tiere. Neuere Erkenntnisse zur «Psyche» des Pferds vermittelte «The Horse Whisperer» (1998), Robert Redfords zweifellos bei weitem beste Regiearbeit, die ihre Wahrhaftigkeit auch der Mitwirkung von Buck Brannaman verdankte, der das Vorbild zum Titelhelden abgegeben hat; der Dokumentarfilm «Buck» (2011) von Cindy Meehl arbeitet seine Methode schön heraus.
Zur Welt der Rodeoreiter gehören auch Kühe. So lernt Robert Mitchum in «The Lusty Men» (1952) von Nicholas Ray Überraschendes zur Gefährlichkeit der Zebubullen, die diejenige der europäischen Rassen weit übersteigt. Brown Eyes, die aparte Hauptdarstellerin von Buster Keatons «Go West» (1925), dürfte die einzige mit Namen versehene Kuh unter den Abertausenden von Artgenossen sein, die in zahllosen Western über die grossen Trails getrieben wurden. Im Schweizer Film haben es überraschenderweise nur die Eringerkühe zu Leinwandheldinnen gebracht. Sehr viel eindringlicher als der platte Spielfilm «Le combat des reines» (1995) von Pierre-Antoine Hiroz ist dabei der Dokumentarfilm «Kampf der Königinnen» (2011) von Nicolas Steiner. In seinem Dokumentarfilm «Q – Begegnungen auf der Milchstrasse» (2000) sorgt Jürg Neuenschwander für tatsächlich ungewöhnliche Begegnungen, wenn er Viehzüchter aus Burkina Faso und Mali mit der Schweizer Milchwirtschaft in Kontakt bringt.
Subgenres, in denen Tiere naturgemäss eine wichtige Rolle spielen, sind der Zoo-, der Zirkus- und der Jagdfilm. In «A Zed & Two Noughts» – «Zoo», buchstabiert –, einem seiner postmodernen Meisterstücke fürs Kino, lässt Peter Greenaway 1985 zwei Zwillingsbrüder Forschungen im Zoo betreiben und dekonstruiert die Prozesse der Natur zum monströsen Zersetzungsvorgang. Frederick Wiseman hat im Zusammenhang mit seinem im Metrozoo von Miami gedrehten, aufschlussreichen «Zoo» (1993) seine Filme generell als «eine Form von Naturgeschichte» bezeichnet. Auch Christoph Schaub interessieren in «Rendez-vous im Zoo» (1995), seinem eindringlichen ersten Dokumentarfilm, der Aufnahmen aus einem halben Dutzend europäischer Tiergärten sowie aus dem Bronx-Zoo in New York versammelt, die Beziehungen des Menschen zum Tier. Das tierische Element im Zirkusfilm ist jüngst wieder reanimiert worden durch die Grossproduktion «Water for Elephants» (2011) von Francis Lawrence sowie durch den soeben an den Visions du Réel in Nyon uraufgeführten, faszinierenden Dokumentarfilm «Wild Women, Gentle Beasts» (2014) von Anka Schmid. Im Zusammenhang mit dem Jagdfilm sei hier kurz an John Huston erinnert, einen fanatischen Jäger, der nicht nur der Fuchsjagd oblag, sondern auch unbedingt einen Elefantenbullen mit riesigen Stosszähnen schiessen wollte, einen «big tusker». Das war ihm 1950 wichtiger als die Dreharbeiten von «The African Queen», wie Peter Viertels brillanter Schlüsselroman «White Hunter, Black Heart» (1990) erzählt, den Clint Eastwood (als «Huston») korrekt, aber wenig inspiriert umgesetzt hat. Der Fluch, unter dem der Jäger steht, liess ihn, mit künstlerisch zwiespältigem Ergebnis, «Moby Dick» (1956) und «The Roots of Heaven» (1958) nach Romain Gary angehen, letzterer trotz schöner Aufnahmen von afrikanischem Grosswild ein unerträgliches All-Star-Vehikel. Den Schritt von der Jagdgeschichte zum einfühlsamen Porträt des wilden Tiers vollzog Jean-Jacques Annauds packender «L’ours» (1988; in dem Bart the Bear in der Titelrolle brillierte), dessen Erfolg «Deux frères» (2004), der Geschichte zweier Tigergeschwister, versagt blieb. Im soeben angelaufenen «Le dernier loup/Wolf Totem» (2014) scheint Annaud eine in die Zeit der chinesischen Kulturrevolution verlegte Variante von Kevin Costners meisterlichem «Dances with Wolves» (1990) realisiert zu haben. Unübertroffen unter all den Wolfsgeschichten bleibt freilich Carroll Ballards «Never Cry Wolf» (1983) nach Farley Mowats grossartigem Buch.
Neben und nach Annaud scheint man sich in Frankreich wieder auf eine etwas vergessen gegangene Tradition des Naturfilms besonnen zu haben. Insbesondere der als Schauspieler international bekannt gewordene Jacques Perrin hat sich grosse Verdienste erworben als Produzent (von «Le peuple singe», 1989, über «Microcosmos – Le peuple de l’herbe», 1996, bis zu «Le peuple migrateur», 2001, und «Océans», 2009, bei dem er auch Regie führte). Luc Jacquet hat nach dem Grosserfolg von «La marche de l’empereur» (2005) – dessen Ursprung im Auftrag Hans-Ulrich Schlumpfs lag, für «Der Kongress der Pinguine» (1993) Winteraufnahmen von Kaiserpinguinen zu machen – mit «Le renard et l’enfant» (2007) versucht, dem Naturfilm «neue» Erzählweisen zu eröffnen (und sich damit, ohne auch nur dessen Namen zu kennen, in die Fussstapfen des überragenden schwedischen Naturfilmers Arne Sucksdorff und dessen Meisterwerk «Det stora äventyret» [Das grosse Abenteuer, 1953] begeben). Nachdem er in «La planète blanche» (2006) die Tierwelt der Arktis noch im herkömmlichen, von den BBC-Produktionen inspirierten Naturkundestil dargestellt hatte, hat Thierry Ragobert mit «Amazonia» (2013) zu einer zauberhaft gelungenen Erzählung gefunden über ein nach einem Flugzeugabsturz unversehens von menschlicher Obhut in die Wildnis des Regenwalds ausgesetztes Kapuzineräffchen. Bei den reinen Tierdokumentationen, in denen seit langem die BBC (und ihr unerreichter Presenter David Attenborough) den state of the art vorgibt, müssen sich auch noch so brillante Produktionen über die afrikanische Tierwelt weiterhin – und häufig zu ihrem Nachteil – am phänomenalen Einfallsreichtum der Filme messen lassen, die Alan und Joan Root in den sechziger und siebziger Jahren geschaffen haben. Alan Root war es auch, der für Michael Apteds «Gorillas in the Mist» (1988) die heiklen dokumentarischen Sequenzen realisierte.
Dass sich Tiere bestens als Komödiendarsteller eignen, weiss nicht nur der Animationsfilm. Mit ungewöhnlichem, zum Teil auch tricktechnisch aufgepepptem Bildmaterial hat der Südafrikaner Jamie Uys in «Animals Are Beautiful People» (1974) die Tierwelt der Kalahari verulkt. Und wie sich eine (witzige) Blödelkomödie machen lässt, ohne dass die Tiere dabei in ihrer Würde beschädigt werden, demonstrierte «Ace Ventura: Pet Detective» (1994) von Tom Shadyac. Ein entfesselter Jim Carrey verkörpert darin den «Schosstierdetektiv», der ihren Besitzern abhandengekommene Lieblinge aufspürt – und zugleich adulte ADHS in Reinkultur: als «anhaltendes Muster exzessiver motorischer Aktivitäten». Höhepunkt des Films ist die Szene zu Beginn, als Ace Ventura, nachdem er endlich hinter seinem misstrauisch witternden Vermieter die Wohnungstür hat zuschmeissen können, einen Pfiff ertönen lässt, worauf sich die leere Wohnung in Sekundenschnelle in die reinste Arche Noah verwandelt, wenn es aus allen Ecken und Winkeln hervor wuselt, kreucht und fleucht. Dass Tiere nicht unbedingt die besseren, aber jedenfalls hundertprozentige Menschen sind, belegen schliesslich Nick Park und Peter Lord in «Creature Comforts» (2003–6), ihrer umwerfenden Fernsehserie mit animierten Plastilinfiguren und authentischen Meinungsäusserungen «of the Great British Public».
Christoph Egger war während dreissig Jahren verantwortlicher Redaktor für Film bei der Neuen Zürcher Zeitung, für die er auch nach seiner Pensionierung noch gelegentlich schreibt.
 Heute
Heute