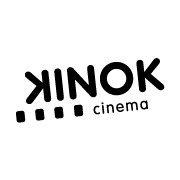In memoriam Ryūichi Sakamoto
Sakamoto erleben
von Jörg Gerle
(Film)musik kann etwas eigentümlich Organisches verströmen. Wenn sie etwa, von einem klassischen Orchester getragen, schlicht Melodien transportiert. Melodien, die «zu Herzen gehen», weil sie uns zusammen mit den Bildern, die sie unterstützen, tief berühren. Die einen mögen dieses Gefühl des Berührtseins, die anderen verkrampfen und verweigern sich dieser «Irrationalität», weil eine fremde Person so unverhohlen mit unseren Befindlichkeiten spielt; übrigens ein wichtiger Grund dafür, dass es ein Publikum gibt, das sich gegen zu emotional wirkende Musik im Film oder gar gegen Kino im Allgemeinen sträubt. Aber das ist eine andere Geschichte …
Ryūichi Sakamoto war ein Meister der Melodie. Aber er gönnte sie uns nicht immer. Das mochte an zwei seiner grundsätzlichen Vorlieben liegen, unter denen der 1952 geborene Tokioter Musik machte. Er war zum einen der Experimentator, der bereits in den 1970er-Jahren die Nähe zu den Schaltkreisen der Synthesizer suchte, als Modul-Modelle wie Moog und Buchla noch kaum mit Populärmusik assoziiert wurden. Zum anderen war er der Dekonstruktivist, der den Wohlklang, der selbst seinem grossen Vorbild Claude Debussy hätte gefallen können, durch nur scheinbar fehlenden Gleichmut ins Unkenntliche fragmentierte.
Unter diesen Voraussetzungen ist es kein Wunder, dass sich bereits seine erste Filmmusik durch einen ganz eigenen Klang auszeichnet. In Stephen Nomura Schibles Dokumentarfilmporträt «Ryūichi Sakamoto: Coda» (2017) bemerkt Sakamoto in einem Nebensatz ein wenig nonchalant, dass er die Rolle des drakonischen Hauptmanns Yonoi in «Merry Christmas, Mr. Lawrence» (1983) nur übernahm, nachdem ihm Regisseur Nagisa Ōshima versprochen hatte, auch die Filmmusik komponieren zu dürfen. Herausgekommen ist nicht nur eine meisterliche Darstellerleistung an der Seite seines «Gegenspielers» David Bowie, sondern auch ein Welthit. Dabei klingt das Titelthema, als würde es stoisch jenem Exotismus folgen, den man erwartet, wenn man in Europa oder Nordamerika an Japan denkt. Die eingängigen japanischen Klischeeakkorde klingen noch ein wenig befremdlicher, weil sie nicht vom grossen Orchester intoniert werden, sondern aus der «billigen» Computerkonserve zu kommen scheinen. Und dennoch, sie haben einen Ohrwurmcharakter wie sonst vielleicht noch Céline Dions My Heart Will Go On aus «Titanic», zumal wenn sie von Japan-Frontman David Sylvian als Forbidden Colors verpoppt im Radio laufen. Da Sakamoto aber neben dem Synthesizer vor allem auch das analoge Klavier liebte, hat er seinen Hit im Laufe der Jahre auch rein orchestral eingespielt. Wer zu den Glücklichen gehört, die auf CD oder Vinyl seine Platte 1996 (Milan Records) im Schrank oder auf dem Computer archiviert haben, der wird wissen, wie organisch Sakamotos Musik klingt, wenn sie für Klavier, Violine und Cello arrangiert ist. Zum Herzerwärmen schön.
Apropos Herzerwärmen. Es mag zu den wunderbaren Fügungen gehören, dass der Italiener Bernardo Bertolucci und der Japaner Ryūichi Sakamoto zunächst für zwei Filme zusammenkamen: Bertolucci, der in den 1980er-Jahren, als das Publikum nach grossem, anspruchsvollem Historien-Emotionskino geradezu gierte, Kostümepen wie «The Last Emperor» (1987) und «The Sheltering Sky» (1990) realisierte. Und Sakamoto, dem neben seiner Elektro-Pop-Ader auch einmal der Sinn nach grosser Klassik stand. Zusammen mit dem Pop-Avantgardisten David Byrne und dem Komponisten Cong Su schuf Sakamoto für «The Last Emperor» prachtvoll verschnörkelte Hollywood/China-Hofstaatmusik und bekam dafür seinen ersten und einzigen Oscar. Für «The Sheltering Sky» gewann Sakamoto «nur» den Golden Globe. Das ist sicher zumindest dem Hauptthema des Films geschuldet, das eben genauso klingt, als begebe sich ein Künstlerehepaar «auf der Suche nach neuen Werten auf eine ziellose Reise durch Afrika, an deren Ende jedoch Tod und die rauschhafte Selbstauslöschung durch den Eros stehen» (filmdienst.de). Rührselig. Tragisch. Sentimental.
Doch Filmmusik besteht eben nicht nur aus dem (bekannten) Titelthema. Die vielen auch noch vorkommenden Rezitative klingen vielmehr nach dem Dekonstruktivisten, der Sakamoto eben auch war und der musikalisch gerne die Nähe zur Avantgarde der 1920er-Jahre von Edgar Varèse bis George Antheil suchte. Hier gibt es keinen Wohlklang im klassischen Sinn mehr. Hier regiert Strenge und Formalismus. Aber Hollywood wäre nicht Hollywood, würde es nicht immer wieder das Klavier und den Weltschmerz einfordern, der so gut zu diesen grossen Epen passt.
Es sollte andere Filme geben, in denen sich Sakamoto austoben konnte. Zum Bespiel in Spanien. Sakamoto war ein Weltenbürger und hatte keine Berührungsängste, weder zu Hollywood noch zum Madrilenen Pedro Almodóvar, der von Bertolucci filmideologisch nicht weiter hätte entfernt sein können. «Tacones lejanos» (1991) atmet Musik. Doch ist es vielleicht eher der Bolero und der spanische Pop-Kitsch als der Klang Sakamotos? Das «Pop-Art-Melodram um Liebe, Leidenschaft und Tod» (filmdienst.de) ist vielleicht zu bunt für Sakamotos Fragmente. Das Titelthema hat zwar genug Weltschmerz für ein Dutzend Almodóvars, doch es wird auch kolportiert, dass der Regisseur mit Sakamotos Filmmusik nicht zufrieden war. Vielleicht, weil Almodóvar keine Diva neben sich duldet. Und die war Sakamoto in den 1980er- und 1990er-Jahren mit Sicherheit.
Eine Diva braucht eine Bühne für sich, und die hat Sakamoto in einer ganz anderen Ecke Spaniens geboten bekommen. Ausgerechnet die Olympischen Spiele in Barcelona 1992 haben den Japaner ganz gross herausgebracht. Die Macher:innen haben bei ihm das musikalische Auftragswerk El Mar Mediterrani bestellt, das sich unter anderem auf seiner brillanten, ebenfalls orchestralen Best-of-CD Cinemage (Sony Classical) findet. Es ist ein eigentümliches, aber auch exemplarisches Stück, das für Ryūichi Sakamotos klassische Seite steht.
Es spricht für Sakamotos polyglottes Musikverständnis, dass ausgerechnet er als Japaner den Auftrag bekam, für die Eröffnungszeremonie eines der musikalischen Zentralstücke zu komponieren. Wie kaum ein:e andere:r Komponist:in verstand er es, die für solch einen Anlass notwendige pathetische Grösse mit Dekonstruktion zu hintertreiben. Als würden die Noten in einem altehrwürdigen Stück plötzlich ein Eigenleben entwickeln, um nach einer Weile einfach nur wildromantisch umherzutanzen und den Wohlklang in repetitive Dissonanzen zu verwandeln, die man landläufig als «Neue Musik» bezeichnet. Nervenaufreibend, bewegend und überhaupt nicht spanisch!
Es mag an seinen ausgiebigen Pop-Ausflügen liegen, dass man den Eindruck hat, Sakamoto hätte sich um die Jahrtausendwende im Kino rar gemacht. Sicher, nach seiner dritten Zusammenarbeit mit Bertolucci («Little Buddha», 1993) oder Classical Cyberspace für Oliver Stones’ Crime-Thriller-Fernsehserie «Wild Palms» (1993) gab es zum Beispiel noch die repetitiven Michael-Nyman-Style-Eskapaden zu «Snake Eyes» (1998) oder die dreiste Pop-Parodie aka Hommage an Ravels Bolero in «Femme Fatale» (2002), doch bei Letzteren sind es eher die visuellen Verrücktheiten des Film-Eklektikers Brian De Palma, die von Sakamotos Spielereien profitieren, als dass man eine musikalische Weiterentwicklung hätte konstatieren können.
Vielleicht liegt es am Arbeiten im Angesicht ständiger Todesangst, die den Komponisten seit Mitte der 2010er-Jahre wegen seiner Krebserkrankung prägte. Jedenfalls klingt sein Spätwerk, als sei es nicht von dieser Welt. Auch wenn der mitunter spröde Politthriller «Minamata» (2020) oder das Astronautinnen-Drama «Proxima» (2019) allenfalls indirekt mit Tod oder Dematerialisation zu tun haben, befindet sich Sakamoto mit seinen elegischen Clustern und Melodiefragmenten längst in der Transzendenz. Der Dokumentarfilm «Ryūichi Sakamoto: Coda», der seine letztlich unheilbare Krankheit, aber auch sein letztes grosses Auftragswerk – die Filmmusik zu Alejandro González Iñárritus «The Revenant» (2015) – thematisiert, lässt das Titelthema zu diesem brachialen Werk gleichsam als zartes Requiem erscheinen. Die Melodien haben sich aufgelöst und sind selbst in den Actionsequenzen allenfalls Statements, die dem Sounddesign weit näher sind als der klassischen Filmmusik. Organisch sind sie dennoch, wenn sie etwa in Takashi Miikes meisterlichem, mit einer atemberaubenden Kamera beseelten Remake von Masaki Kobayashis «Hara-Kiri: Death of a Samurai» (2011) erklingen – und mit nur noch ganz wenigen Tönen tief ins Herz stechen.
Jörg Gerle ist fester freier Filmkritiker beim Filmdienst mit Schwerpunkt Filmmusik und Heimkino. Filmkritiker u.a. für Galore und Cinema Musica. Redaktion für DVD/Blu-ray der Printausgabe des Lexikon des Internationalen Films. Referent für Filmgespräche und Workshops mit Schulkassen im Kino.
 Heute
Heute