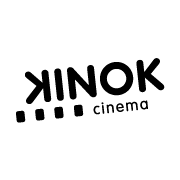Zwischen Erinnerung und Wahrheit:
Sarah Polleys Kino der Geschichten
von Pamela Jahn
Erst sind es nur Worte, die Fiona entgleiten. Dann verschwindet ihre Vergangenheit und bald auch sie selbst. Sie weiss insgeheim, was mit ihr geschieht, aber ändern kann sie es nicht. Die Krankheit des Vergessens hat sich in ihr Leben geschlichen, viel zu früh, viel zu schnell, und jetzt ist es zu spät. Von den Erinnerungen an ihre 45-jährige Ehe mit Grant (Gordon Pinsent) bleiben plötzlich nur noch Bruchstücke und Geschichten über eine vermeintliche Wahrheit, die ihrer verunsicherten Seele Schutz und Geborgenheit gewähren, wenn auch nur für einen flüchtigen Augenblick. Julie Christie ist diese reife, schöne Frau, die in Sarah Polleys «Away from Her» (2006) an Alzheimer erkrankt. Im Pflegeheim begegnet sie einem anderen Mann, der sich ebenfalls in einer alternativen, seiner ganz privaten Realität eingerichtet hat, in der es kein Gestern und kein Morgen gibt. Grant muss zusehen, wie Fiona sich zwischen jedem Besuch weiter von ihm entfernt – und wie sehr sie leidet, als ihre gerade beginnende Bekanntschaft eines Tages abrupt von der Ehefrau ihres neuen Partners zerschlagen wird. Liebe, auch das zeigt der Film mit grosser Sensibilität, ist immer relativ, immer absolut.
Dass Polley sich für ihr Regiedebüt ausgerechnet einer Geschichte über die Bedeutung der Erinnerung angenommen hat, kommt nicht von ungefähr. Es ist eines der grossen Themen in ihrer persönlichen Biografie. Wie zerbrechlich und fliessend, verwirrend und bezaubernd die Bilder und Gefühle sind, die sich in unserem Kopf, manchmal im ganzen Körper festsetzen, davon erzählen alle ihre Filme, einer klüger und warmherziger und ehrlicher als der andere. Und sie verraten noch mehr: über die Schwere wichtiger emotionaler Entscheidungen und darüber, was es bedeutet, eine selbstständig handelnde und frei denkende Frau in einer patriarchalischen Welt zu sein. So zeigt etwa «Take This Waltz» (2011) eine festgefahrene Michelle Williams in der Ehekrise, die in einem verbotenen Flirt mit ihrem gutaussehenden Nachbarn (Luke Kirby) einen Ausweg aus der Mittelmässigkeit entdeckt. Doch es ist Polleys Dokumentarfilm «Stories We Tell» (2012), der schliesslich ihr grosses Talent für ungewöhnliche, eigenwillige Erzählformen erkennen lässt.
Als die 1979 in Toronto geborene Tochter einer Schauspielfamilie vor etwa gut fünfzehn Jahren beschloss, einen Dokumentarfilm über ihre Mutter zu drehen, die sie mit elf an den Krebs verloren hatte, konnte sie nicht ahnen, welch aussergewöhnliches Geheimnis sie damit lüften würde. «Stories We Tell» ist das verblüffende Ergebnis ihrer Recherche, eine filmische Erinnerung an ihre Eltern und das aufschlussreiche Selbstporträt einer Grossfamilie. Was den Film so besonders macht, ist jedoch nicht nur das intime Rätsel im Zentrum, das Polley mit detektivischer Genauigkeit und viel Feingefühl offenlegt. Es sind die Fragen, die über die Handlung hinausgehen: Sind wir die Schöpfer:innen unserer Geschichten oder schreiben sie uns? Wer bestimmt, was in der Vergangenheit tatsächlich wahr oder vielleicht doch nur eine verblasste Sehnsucht ist? Und warum ist die Erinnerung, so unzuverlässig und komplex sie erscheint, stets eine so reizvolle Quelle, wenn es darum geht, unserer inneren Identität auf die Spur zu kommen?
«Das Erzählen von Geschichten ist unsere Art der Bewältigung», sagt Polley, die zierlich ist, wie eine Tänzerin, aber mit einer Stimme voller Überzeugung und Nachdruck spricht. «Es ist eine Art, dem Chaos eine Form zu geben.» Und wenn man die engagierte Regisseurin reden hört, bekommt man leicht eine Vorstellung davon, warum sie jetzt ein so verstörendes und vielschichtiges Buch wie Women Talking von Miriam Toews verfilmt hat. Aus ihr spricht die Leidenschaft fürs Erzählen und für einen Beruf, den sie aufgrund einer langwierigen Gehirnerschütterung, die sie vor einigen Jahren erlitten hat, lange Zeit nicht ausüben konnte. Blickt man jedoch noch ein bisschen tiefer in Polleys persönliche Lebensgeschichte zurück, wird deutlich, dass der monströse Stoff, den sie in ihrem unlängst oscarprämierten Drama behandelt, nicht zuletzt einen wunden Punkt in ihrer eigenen Vergangenheit trifft.
Schon ihre frühe Kindheit hat Polley grösstenteils vor der Kamera verbracht. Sie hat mit Hal Hartley, David Cronenberg und auch mit Wim Wenders gearbeitet, aber am Set nicht nur positive Erfahrungen gemacht. Während Atom Egoyan, in dessen Filmen sie wiederholt mitspielte, später ein entscheidender Mentor werden sollte, war insbesondere ihre frühe Zusammenarbeit mit einem bedingungslosen Visionär wie Terry Gilliam vor allem von traumatischen Ereignissen geprägt. Und auch Polley hat als junge Schauspielerin den Missbrauch von Macht in Hollywood aus erster Hand erfahren. In einem Meinungsartikel in der New York Times aus dem Jahr 2017 schrieb sie über ihre zutiefst beunruhigende Erfahrung mit Harvey Weinstein; ein Essay in ihrem vor wenigen Monaten erschienenen Buch Run Towards the Dangerbeschreibt, wie sie als 16-Jährige einen sexuellen Übergriff erlebte.
Aber «Women Talking» ist kein Film, der das Böse glorifiziert. Polley inszeniert die Gespräche dreier Generationen von Frauen, die in einer traditionellen Glaubensgemeinschaft leben und jede für sich Opfer eines allumfassenden Missbrauchsskandals geworden sind, weitestgehend als isoliertes, hoffungsvolles Kammerspiel, das auch Raum für Humor und Leichtigkeit lässt. Während die Männer der Kolonie in die Stadt fahren, um die Kaution für die inhaftierten Täter zu bezahlen, versammelt sich eine kleine Gruppe auserwählter Frauen auf einem Heuboden, um zu beschliessen, wie sie auf die Enthüllungen reagieren sollen. Und die Kamera schaut und hört ihnen aus der Distanz zu, wie eine Fliege an der Wand, ohne zu werten. Die Worte und Bilder brennen sich dadurch nur noch tiefer ins Gedächtnis ein.
Polleys eigener bemerkenswerter, aber nicht ungetrübter Werdegang prägt bis heute ihren Blick. Und dazu gehören auch die oft schwierigen Rollen, die sie stets mit viel Bedacht ausgewählt hat. Als sie für den schwülen Erotikthriller «Exotica» (1994) zum ersten Mal mit Egoyan dreht, ist sie kaum fünfzehn; drei Jahre später übernimmt sie in «The Sweet Hereafter» (1997) die Figur der ebenso verstörten wie verstörenden Nicole, die in der kanadischen Provinz British Columbia ein schreckliches Schulbusunglück überlebt. Als die Halbwüchsige im Rollstuhl aus dem Krankenhaus zurückkehrt, muss sie nicht nur das unmittelbare Unglück verkraften, sondern auch die merkwürdigen Bilder in ihrem Kopf zuordnen, die eine Ahnung von Inzest in ihrem eigenen Kinderzimmer freilegen, wo bisher nur Platz für Mädchenträume war.
Von den komplexen emotionalen Strukturen in Egoyans Filmen ist Polley immer fasziniert gewesen. Doch es war der Austausch mit so unterschiedlichen und zugleich ähnlich gesinnten Filmemacherinnen wie Kathryn Bigelow und Isabel Coixet, die Polley schliesslich die nötige Kraft und den Rückenwind für eine eigene Karriere hinter der Kamera gaben. Vor allem für Coixet liess sich Polley immer wieder tief auf labile, innerlich gebrochene Figuren ein. Ob als junge, krebskranke Mutter in «My Life Without Me» (2003) oder als stark traumatisierte Arbeiterin in «The Secret Life of Words» (2005): Die von ihr stets mit unbedingtem Mitgefühl verkörperten Charaktere werden aus ihrem bisherigen Dasein gerissen und sind gezwungen, sich auf neue Erfahrungen und Emotionen einzulassen, auch wenn es das Letzte ist, was sie tun.
In der Erinnerung ist die Welt immer eine andere. Es ist das Kino in unseren Köpfen, das unser Denken bestimmt. Was wir gestern erlebt haben, ist in unserem Bewusstsein heute lediglich noch eine Vorstellung, eine Interpretation, manchmal eine Sehnsucht, im schlimmsten Fall ein Alptraum. Das Schöne an der Erinnerung ist, dass sie uns nicht nur trügt, sondern auch glücklich machen kann – sie ist immer Freud und Leid zugleich. Wie das Kino von Sarah Polley, das immer dicht am Leben bleibt.
Pamela Jahn ist freie Autorin und Journalistin. Sie schreibt u.a. für das ray Filmmagazin, FAQ und Filmbulletin. Sie lebt in London und ist dort auch als Übersetzerin und Filmkuratorin tätig.
 Heute
Heute