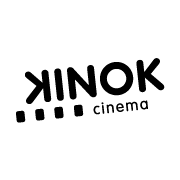Jane Campion – Die Kraft des anderen Blicks
von Pamela Jahn
Sie ist ein Problemkind, das merkt man gleich. Ein grosses Mädchen, verletzlich und unvernünftig zugleich. Ein Freigeist und ein Störenfried, die Nervensäge vom Dienst. Laut und extravagant poltert sie durch den Tag, eckt immer wieder an mit ihrer Scheuklappensicht auf die Welt und wirkt auf eine Art egoistisch, die zwar penetrant, aber nicht berechnend erscheint.
Die Rede ist natürlich nicht von der Regisseurin, um die es hier geht, sondern von der Figur, der Jane Campion in ihrem Spielfilmdebüt «Sweetie» (1989) ihre ganze Aufmerksamkeit schenkt: eine labile junge Frau, die davon träumt, Schauspielerin zu werden, aber mit ihrer zerstörerischen Unbeständigkeit den Menschen, die ihr am nächsten stehen, pausenlos Schaden zufügt. Dabei rückt Geneviève Lemon, die im Film eigentlich Dawn heisst, aber von allen nur bei ihrem titelgebenden Spitznamen genannt wird, überhaupt erst ins Bild, als es für die Hauptrolle eigentlich längst zu spät ist. Dreissig Minuten vergehen, bis sie eines Nachts im Haus ihrer Schwester Kay (Karen Colston) auftaucht und von dem Moment an deren Leben und das ihrer gesamten Familie gehörig auf den Kopf stellt.
Die Welt von Sweetie wird im weiteren Verlauf des Films von Campion mit fast unfassbar subtiler Präzision aus der Form gebogen. Aber was ein düsteres Drama hätte werden können, gleicht die Regisseurin durch eine geheimnisvolle Atmosphäre aus, die zunehmend mystisch wirkt. Das schiefe Bild von einer umgestürzten Wäscheleine und einem Baum, der behelfsweise als Sockel dient, verweist bereits früh auf Campions mysteriösen visuellen Stil, der in einer Art Zwischenwelt existiert: «Sweetie» ist ein Film, der sich an sein Publikum heranschleicht wie ein Traum, der Realität wird und doch rätselhaft bleibt und der auf seltsam spürbare, fast haptische Weise nach und nach seine Abgründe freilegt.
Ähnlich wie die Heldin in ihrem kühnen Leinwanddebüt ist auch die 1954 in Wellington geborene Campion immer ihrem eigenen, unkonventionellen Rhythmus gefolgt. Von vornherein hat sie sich bewusst den herrschenden Konventionen widersetzt und es doch irgendwie geschafft, in den überwiegend männlichen Hollywood-Mainstream einzudringen. Ihr jüngstes Werk, «The Power of the Dog», für das sie im vergangenen Jahr mit dem Oscar für die beste Regie ausgezeichnet wurde, ist ein so kraftvolles, filigranes und zugleich zermürbendes Werk wie der Film, mit dem die Neuseeländerin 1993 ihren bisher grössten Erfolg feierte: Für «The Piano» wurde Campion nicht nur als erste Frau überhaupt mit der Goldenen Palme des Festivals von Cannes geehrt, sondern zudem mit einem Oscar für das beste Drehbuch ausgezeichnet.
Im Zentrum steht Holly Hunter als Ada: eine zierliche Frau von kaum dreissig Jahren, stumm und scheu, den Körper in ein schwarzes Dienstkleid gedrängt, das Gesicht verschlossen, die Mine reglos, beinahe hart. Um diese Ada strickte Campion eine Liebesgeschichte – und einiges mehr. Es war der Versuch, mit dem Kino, das so lange, zu lange von den Männern dominiert wurde, auf eine neue, eine ganz und gar andere Weise zu spielen – so wie Ada auf ihrem Klavier, von innen heraus, aus dem Herzen und mit dem Blick einer weiblichen Instanz.
Dafür wurde Campion gefeiert, obwohl sie sich bereits in ihren frühen Kurz- und TV-Filmen jenem Female Gaze verschrieben hatte, den sie in «Sweetie» zu ihrer ganz persönlichen Kunst machte. Dennoch musste sie zur Zeit der Erstveröffentlichung des Films auch herbe Kritik einstecken: Während einige einflussreiche Kritiker:innen wie Vincent Canby von der New York Times sich dafür begeisterten, taten andere es als «widerliches, unsinniges Melodrama» ab. Aber Campion liess sich nicht verunsichern, verfilmte anschliessend unter dem Titel «An Angel at My Table» (1990) die Autobiografie der neuseeländischen Schriftstellerin Janet Frame, die Armut und Geisteskrankheit überlebte, bis Ada und ihr Piano die weibliche Perspektive im bildgewaltigen Kino der Regisseurin raffiniert perfektionierten.
Campion, die selbst aus kreativen, unstabilen Familienverhältnissen stammt (ihre Eltern gründeten die Theatergruppe New Zealand Players), studierte zunächst Anthropologie an der Universität in Wellington, bevor sie nach London zog und sich an der Chelsea School of Art einschrieb. 1980 drehte sie aus Frustration über die Malerei den Kurzfilm «Tissues» und zog kurzerhand nach Sydney, um dort ein Filmstudium aufzunehmen. «Das Filmemachen hat mich befreit», sagt sie heute. «Bevor ich es entdeckte, hatte ich eine Menge Energie, aber ich wusste nicht, wie ich sie ausdrücken oder überhaupt in der Welt sein sollte. Ich fand die Herausforderung, einen Film zu machen, so aufregend, dass es war, als hätte ich mich selbst gefunden.»
Seitdem schafft die herrlich widerständige Regisseurin vornehmlich Werke, die das Anderssein in den Vordergrund stellen: Ob Einzelgängerinnen oder Träumerinnen, Unverstandene und psychisch Kranke, immer rückt sie Frauen ins Bild, die sie in all ihrer seltenen Schönheit, aber auch mitsamt den oft brutal zur Schau gestellten «hässlichen Seiten» ihres Charakters zeigt. Ihre Faszination für das Abwegige ist dabei stets offensichtlich. Ihr Kino ist unverschämt sinnlich, impressionistisch und oft zweideutig – und auch die Ergebnisse sind dementsprechend betörend und frustrierend zugleich.
Auch deshalb waren Hollywood und Campion immer schon ein schwieriges Paar. Zunächst schien alles vielversprechend zu laufen, zumal die dreistündige Fernsehproduktion «An Angel at My Table» so erfolgreich war, dass der Film schliesslich auch in die Kinos kam. Und nachdem Campion die Branche mit «The Piano» einmal erobert hatte, versuchte sie, auch in den Folgejahren eine Karriere als aufstrebende Filmemacherin weiterzuführen – wenn auch mit gemischtem Erfolg.
Ihre 1996 gedrehte Adaption von «The Portrait of a Lady», dem Romanklassiker von Henry James, liess zwar angesichts der Starbesetzung mit Nicole Kidman und John Malkovich auf den ersten Blick eine stilvolle Literaturverfilmung vermuten. Tatsächlich dekonstruiert Campion die Geschichte jedoch beinahe fieberhaft bis ins kleinste Detail, dass es vielen regelrecht ungeheuerlich erschien. Als noch gewagter entpuppten sich sowohl «Holy Smoke» (1999), in dem Kate Winslet eine junge Aussteigerin spielt, die gegen den Willen ihrer Familie nach Erleuchtung strebt, als auch der erotische Psychothriller «In the Cut» (2003), in dem Meg Ryan eine sexuelle Faszination für einen grausamen Frauenmörder (Mark Ruffalo) entwickelt und beinahe selbst zu seinem Opfer wird. Vor allem in Letzterem verdrehte Campion den Stoff in immer unvorhergesehenere Richtungen, abstrahierte die Erzählung und ignorierte jegliche Genrekonventionen, um die Machtdynamik in heterosexuellen Beziehungen auf ihre Weise zu hinterfragen.
Danach legte die Regisseurin zunächst eine längere Pause vom Kino ein, «um neue Inspiration zu finden», wie sie es einmal der NZZ gegenüber formulierte. Aber auch um sich um ihre Tochter Alice zu kümmern, nachdem ihr Sohn Jasper kurz nach ihrem Siegeszug mit «The Piano» wenige Tage nach seiner Geburt überraschend verstorben war. Der Abstand zur Regiearbeit tat ihr allerdings sichtlich gut, denn 2009 legte sie mit «Bright Star» einen der schönsten Liebesfilme überhaupt nach. Erzählt wird darin die wahre Geschichte des britischen Dichters John Keats (Ben Whishaw) und seiner Nachbarin Fanny Brawne (Abbie Cornish), und es ist wahrlich eine Leinwandbegegnung der besonderen Art: ein zartes Drama, das sich behutsam einfühlt in seine Akteur:innen, in den Strudel der unerfüllten Emotionen, ohne dabei jemals kitschig oder abgeschmackt zu wirken, und ein Beleg für die Wirkkraft und Lebendigkeit, die sich immer wieder aus den erstarrtesten Formeln gewinnen lässt.
Wie alle Auteur:es, denen die Allgewalt über ihre Werke heilig ist, hat auch Campion eine spezielle Vision, die sich in ihren Filmen mal mehr, mal weniger greifen lässt. Eine Vision, in der sich bestimmte, meist zutiefst persönliche Themen und ihre eigenwillige visuelle Handschrift zu einem grossen Ganzen vereinen. Und im Grunde wäre die Lebensgeschichte von Campion selbst es wert, einmal verfilmt zu werden, so voller wechselnder Schauplätze und starker, unabhängiger Frauen, komplexer Geschwisterbeziehungen und zerrütteter Familienverhältnisse, privater Schicksalsschläge und unglücklicher Liebesbeziehungen sie ist. Aber wer könnte bei einem solchen Film Regie führen? Es bräuchte eine Filmemacherin, die sich in dem Metier auskennt und die sich der Männerwelt, in der sie sich bewegt, mutig und kraftvoll entgegenstellt. Eine einzigartige, unerschrockene und stilbewusste Regisseurin eben – eine wie Jane Campion selbst.
Pamela Jahn ist freie Autorin und Journalistin. Sie schreibt u.a. für das ray Filmmagazin, FAQ und Filmbulletin. Sie lebt in London und ist dort auch als Übersetzerin und Filmkuratorin tätig.
 Heute
Heute