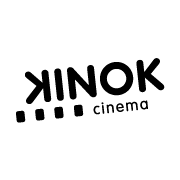David Bowie – Nicht von dieser Welt
von Pamela Jahn
Als Rockstar war er der Grösste. Auf der Bühne lebte er sich aus – rastlos, rückhaltlos. Hier durfte er alles sein und alles spielen, mit anderen Identitäten flirten und sämtliche Grenzen überschreiten. Denn David Bowie war einer wie keiner: ein endlos kreativer Schöpfer, der die Fähigkeit besass, sich selbst als künstlerische Figur fortwährend neu zu erfinden. Der nicht nur musikalisch seine Wandelbarkeit zelebrierte, sondern obendrein schauspielern konnte. Und der das Kino liebte, so wie das Kino ihn, in all seinen Facetten und Schattierungen.
Insgesamt 28 Filme hat Bowie gedreht. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätten es ruhig noch mehr sein können. Im Grunde kam jede einzelne seiner Live-Shows stets einer gewaltigen Performance gleich: Mit der Musik im Rücken genoss er das Rampenlicht, sein Star-Dasein und die Begeisterung des Publikums. D. A. Pennebakers Konzertfilm «Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» (1973) dokumentiert ihn auf dem ersten Zenit seiner Karriere, beim letzten Konzert der Ziggy-Stardust-Tournee, am 3. Juli 1973 im Londoner Hammersmith Odeon. Der britische Regisseur Nicolas Roeg sah den Film und wusste, dass er soeben den Hauptdarsteller für sein aussergewöhnliches Spielfilmdebüt «The Man Who Fell to Earth» (1975/76) gefunden hatte. Denn nur ein Individualist wie Bowie konnte den aparten Ausserirdischen Thomas Jerome Newton verkörpern und ihn glaubhaft unter das Menschenvolk mischen. Im Gegenzug brachte Roeg zum ersten Mal Bowies ureigene, befremdlich bestechende Leinwandpräsenz zum Vorschein, inklusive der markant hervorstechenden Wangenknochen seines zu dem Zeitpunkt noch stark kokainbeeinflussten Hauptdarstellers. Zwar bestand nach dem offiziellen Abgang des Glamrockstars Ziggy Stardust, den Pennebakers Dokumentation bescheinigte, kein Zweifel daran, dass Bowie auch im Kino das Publikum mit seiner extrovertierten Virtuosität elektrifizieren würde. Doch Roeg verstand es wie kein anderer, dessen ebenso kühles wie androgynes Ego für seine Zwecke einzusetzen, und Bowie, nun ganz der «Thin White Duke», hatte sichtlich Spass an der Verkörperung jenes verkappten Aliens, der auf die Erde gesandt wird, um nach Wasser für seinen entfernten Wüstenplaneten zu suchen. Für den unermüdlichen Künstler, der immer zuerst Musiker und in zweiter Linie Schauspieler war, kam die Rolle nicht zuletzt einer Art Fortsetzung seiner «Space Oddity»-Hitsingle aus dem Jahr 1969 gleich, deren einsamer Astronaut Major Tom in den Achtzigerjahren ebenfalls seine Wiederauferstehung erleben sollte.
Mit jedem Jahrzehnt, um das er seine Karriere erweiterte, schien Bowie nie wirklich älter, sondern lediglich wandlungsfähiger zu werden, was sich gleichermassen auf seine Bühnencharaktere wie auf seine Filmrollen auswirkte. Musikalisch betrachtet gab es wohl kaum einen Trend, den Bowie nicht erprobt und bestenfalls für sich selbst in Anspruch genommen hat. Und ähnlich sprunghaft wechselte er auch durch die verschiedensten Filmgenres, je nachdem, wie es der Regisseur verlangte, dem er sich gerade verpflichtet hatte. Doch bevor sich der 1948 im Arbeiterviertel Brixton als David Robert Jones geborene Londoner unter der Federführung so namhafter Filmemacher wie Nagisa Ōshima, Jim Henson oder Christopher Nolan behaupten sollte, versetzte er seinem frischgebackenen Filmstarstatus 1978 mit der Hauptrolle in David Hemmings’ «Schöner Gigolo, armer Gigolo» einen unvorhergesehenen Seitenhieb. Der Film, in dem er sich als eleganter Eintänzer durch das Berlin der Zwanzigerjahre schlägt, wurde in Bowies eigener Berlinzeit mit Starbesetzung (unter anderem Maria Schell, Curd Jürgens und Kim Novak) gedreht und sollte obendrein der letzte grosse Auftritt von Marlene Dietrich werden. Er floppte allerdings an den Kinokassen so kolossal, dass Bowie sich lange davon zu distanzieren versuchte – zu Unrecht, wie sich später herausstellen sollte. Denn abgesehen davon, dass Bowie über die Jahre mehr als einmal ein unglückliches Händchen bewies, was die Wahl der Drehbücher anging, ist der selten gezeigte Film vor allem aufgrund des charismatischen Spiels seines Hauptdarstellers einen Besuch wert, was «Schöner Gigolo, armer Gigolo» schliesslich einen wohlverdienten Platz unter den seltenen Kultklassikern einbrachte.
Dass Bowies ureigener Instinkt für das Kino zudem weitaus komplexer war, als ein kurzer Blick auf seine frühe Filmografie vielleicht vermuten lässt, machen vor allem die Achtzigerjahre deutlich. Denn obwohl ihm die Rolle des alternden Vampir-Lovers an der Seite von Catherine Deneuve in Tony Scotts stilisiertem Gothic-Horror «The Hunger» (1982/83) so offensichtlich auf den Leib geschrieben schien wie einst die des Thomas Jerome Newton, war es seine überraschend vollblutige Darstellung des rebellischen Häftlings Jack Celliers in Nagisa Ōshimas japanischem Kriegsgefangenendrama «Merry Christmas Mr. Lawrence» von 1982/83, mit der er Publikum und Kritik gleichermassen tief beeindruckte. Ōshima, der Bowie nach dessen meisterlichem Auftritt als John Merrick in der Broadway-Produktion «The Elephant Man» gewissermassen von der Bühne weg gecastet hatte, schien ähnlich wie Roeg verstanden zu haben, dass hinter der aalglatten Hülle auch in Bowie ein zutiefst menschlicher Kern steckte, der in jener mit Schuld be- und nicht selten homoerotisch aufgeladenen Atmosphäre, in der Ōshima seine Geschichte angesiedelt hatte, auf eindringliche Weise zum Tragen kam.
Drei Jahre später verbündete sich Bowie mit dem Regisseur Julien Temple, dem er den Clip zu «Blue Jean» verdankte. Der Musikvideopionier hatte ein Rock-Musical über das Erwachen der Popkultur im London der Fünfzigerjahre im Sinn und Bowie erwies sich einmal mehr als der Mann der Stunde. So steuerte er nicht nur den Titelsong zu «Absolute Beginners» (1985/86) bei, sondern übernahm zudem eine Nebenrolle als skrupelloser Immobilienhai, während auch Sade und Kinks-Frontmann Ray Davies das Projekt mit kleineren Gastauftritten unterstützten. Und auch in den Jahren danach probierte sich Bowie immer wieder in weiteren Nuancen seines selbstironischen Leinwandpotenzials, wie beispielsweise in Julian Schnabels unterschätztem Künstlerporträt «Basquiat» (1996), in dem er es mit keinem Geringeren als Andy Warhol aufnehmen sollte, dem er darin ein angemessen überspitztes und zugleich inniges Denkmal setzte.
Sich auf eine Kunstform zu beschränken, würde ihm Angst machen, hat David Bowie einmal gesagt, und doch zog er sich im Alter bewusst von der Leinwand zurück. Aber selbst seinen Abschied hatte er beinahe filmreif geplant, inklusive der Veröffentlichung des letzten Albums «Blackstar» zwei Tage vor seinem Tod. Die Nachricht, dass Bowie seinen kurzen, aber hartnäckigen Kampf gegen den Krebs am 10. Januar 2016 endgültig verloren hatte, kam damals nicht nur für viele Britinnen und Briten einem «Diana-Moment» gleich, so unerwartet und in seiner Wucht unermesslich, dass den meisten erst in dem Augenblick bewusst wurde, wie persönlich sie der Verlust treffen sollte. Hatte man bis dahin doch insgeheim gehofft, dass der Mann, der so offensichtlich nicht von dieser Welt war, irgendwie für immer bleiben würde. Der Einzige, der wusste, dass es anders kommen würde, weil er dem Hier und Jetzt stets mindestens einen Schritt vorauseilte, war Bowie selbst.
Pamela Jahn ist Autorin und Filmjournalistin. Sie schreibt u.a. für das ray Filmmagazin, für Sight & Sound, FAQ und das Electric Sheep Magazine. Sie lebt in London und ist dort auch als Filmkuratorin tätig.
 Heute
Heute