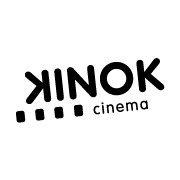Che vuoi?
Männer am Rande des Nervenzusammenbruchs
von Johannes Binotto
An einer Neurose zu leiden, bedeutet an einer Frage zu leiden – so heisst es beim Psychoanalytiker Jacques Lacan. An der Frage nämlich, was die anderen von mir wollen. «Welche verkappten Ansprüche, welche geheimen Vorwürfe stecken hinter den scheinbar banalen Dingen, die mir die anderen sagen?», so fragen sich die Neurotischen unablässig. Oder mit Lacans Kurzformel gefragt: «Che vuoi? – Was willst Du?»
Wenn uns bei diesem «Che vuoi?» weniger das Bild einer händeringenden Frau mit zerzausten Haaren einfällt, wie man Anfang des 20. Jahrhunderts gerne die sogenannten Hysterikerinnen dargestellt hat, sondern wir eher einen aufgebrachten Mafioso vor uns sehen, der seine Gefolgsleute anschnauzt, dann ist diese Verschiebung durchaus beabsichtigt. Denn entgegen dem nicht zuletzt von männlichen Medizinern gern verbreiteten Klischee ist die Neurose beileibe keine bloss weibliche Angelegenheit, sondern blüht erst recht dort, wo sich Männer auf eigenem Terrain wähnen. Die Neurose ist auch und gerade das Symptom einer von Männern dominierten Kultur. Im Kino führt uns das der Regisseur Howard Hawks gleich in mehreren seiner bei genauerer Betrachtung ziemlich queeren Filme vor, in denen die Frauen immer viel souveräner agieren als die männlichen Profis, die sich vielmehr meist als Fachidioten entpuppen: In «I Was a Male War Bride» wird ein strammer Armeehauptmann über den Verlauf des ganzen Films so lustvoll und so lustig demontiert, dass er am Ende selber nicht mehr weiss, wer er ist. Dass es dabei ausgerechnet das sonst so elegante Mannsbild Cary Grant ist, das sich hier am Ende von chauvinistischen Matrosen für seine schönen Beine Komplimente anhören muss, macht das Ganze nur noch überraschender und damit vergnüglicher. Indes entsteht bei Hawks die Neurose nicht einfach aus einer simplen Verkehrung von männlichen und weiblichen Stereotypen. Hawks’ Analyse neurotischer Strukturen geht tiefer und ist damit subversiver: Die hysterisch machende Frage, was denn die anderen von einem wollen, ergibt sich in «I Was a Male War Bride» nicht aus den Geschlechterverhältnissen, sondern direkt aus der absurden Militärbürokratie voller bizarrer Regeln, endloser Formulare und nicht entzifferbarer Abkürzungen. Che vuoi? – das fragen sich hier nicht nur die verunsicherten Männer angesichts der selbstbewussten Frauen, sondern letztlich alle, die auf den Fluren der unzähligen Armeebüros umherirren. Wer würde in diesem Dschungel der Paragrafen nicht einen Nervenzusammenbruch erleiden?
Es ist derselbe Regelwahn, der auch in «The Odd Couple» Walter Matthau angesichts seines kontrollsüchtigen und andauernd die Küche aufräumenden Mitbewohners Jack Lemmon konsequent zur Verzweiflung treibt. Und wer meint, nur der hypochondrische Mitbewohner mit all seinen nervigen Ticks sei hier der Neurotiker, hat bloss nicht lang genug hingeschaut: Was «The Odd Couple» stattdessen erzählt, ist, wie die Neurose alsbald alle ansteckt, weil sie eben nicht bloss in einzelnen Personen steckt, sondern in einer von absurden Regeln regierten Welt und ihren labyrinthischen Strukturen.
Es ist diese kafkaeske Welt, in die sich auch der junge Drehbuchautor Barton Fink gestossen sieht, der frisch angekommen in Hollywood immer weniger versteht, was all die Personen von ihm wollen, die in seinem schmuddeligen Hotelzimmer ein und aus gehen. Die Coen-Brüder liefern mit Barton Fink die Blaupause für all jene neurotischen Männer, um die sich ihr Werk bis heute fast ausschliesslich dreht. So wie sich Barton Fink im gleichnamigen Film am Ende in sein eigenes Drehbuch hineinschreibt, könnten auch alle weiteren Filme der Coens von dem fiktiven Autor Fink verfasst worden sein. Wäre das nicht eine schöne, Kafka-würdige Volte, dass die Coen-Filme eigentlich nur die Erfindung von deren eigenen Figuren sind?
Wer Autor und wer Figur ist, wird immer undurchschaubarer, und was der eine vom anderen will, das fragt sich mit Barton Fink auch der Protagonist in Marc Forsters «Stranger Than Fiction», der eines Tages die Stimme jener Autorin hört, die sein Leben schreibt. Die Frage des «Che vuoi?» wird damit endgültig existenziell: Denn zu wissen, was die Autorin vorhat, ist für ihre Romanfigur nichts weniger als eine Frage von Leben und Tod. Immerhin hat Will Ferrell in «Stranger Than Fiction» die Möglichkeit, die Verwalterin seines Geschicks selber zu fragen, was sie von ihm wolle. Diesen Luxus kennt Bill Murray in «Groundhog Day» nicht: Als er erkennen muss, dass er dazu verdammt ist, denselben Tag immer wieder neu zu durchleben, ohne Hoffnung auf Veränderung oder Tod, gibt es weder Gott noch Göttin, die ihm erklären, warum. Die Frage aber, was das Ganze soll, stellt sich damit umso schmerzhafter, gerade weil es keine Instanz gibt, an die man sie richten kann. Das ist eigentlich der Stoff, aus dem schon Andrei Tarkowski oder Ingmar Bergman ihre Dramen gemacht haben – nur dass es bei ihnen weniger zu lachen gab als im brillanten «Groundhog Day». Dass indes der Weg aus der nervenzerrüttenden, in Endlosschlaufe drehenden Frage nach dem Sinn der eigenen Existenz ausgerechnet in männlicher Selbstoptimierung liegen soll, macht den Film dann doch wieder recht amerikanisch.
Einen anderen Dreh sucht und findet Henri Boulanger in Aki Kaurismäkis «I Hired a Contract Killer», der sich einen Profikiller sucht, um seinem aussichtslosen Leben ein Ende zu setzen, und dadurch wieder Lust auf dieses bekommt. Dieselbe Geschichte hat bereits Jules Verne in seinem Roman «Die Leiden eines Chinesen in China» erzählt und damit eigentlich eine Verteidigung der Neurose als lebensbejahendem Motor geschrieben. Vernes Hauptfigur ebenso wie Henri Boulanger in Kaurismäkis Film fragen sich schon lange nicht mehr, was die anderen von ihnen wollen, und haben genau deswegen den Geschmack am Leben verloren. Mit dem festgesetzten Tod jedoch taucht die Frage nach dem Sinn des Lebens und danach, was die anderen von einem wollen, wieder auf. Oder anders gesagt: Der Sinn des Lebens besteht offensichtlich nicht darin, eine Antwort, sondern eine Frage zu haben. Neurotisch sein oder gar nicht – so lautet die Alternative. So gesehen ist das nervige «Che vuoi?» dann doch dem fraglosen Tod vorzuziehen.
Und merken wir es nicht all den Neurotikern des Kinos an, dass ihnen eigentlich gar nicht so unwohl ist in ihrer Nervosität? Der grimassierende Louis de Funès in Claude Zidis «L’Aile ou la cuisse» oder der mit Uwe Ochsenknecht rangelnde Heiner Lauterbach in Doris Dörries «Männer»; der wie immer vom Regisseur selbst gespielte beziehungsgestörte Pechvogel in Woody Allens «Annie Hall» oder der die löchrige Krimihandlung entlangstolpernde Detektiv Brenner im Wolf-Haas-Krimi «Das ewige Leben» – sie alle führen die unseligen Situationen, in denen sie auf die Schnauze fliegen, immer wieder selbst herbei. Sie alle benehmen sich gerade so wie die Trinker in Thomas Vinterbergs «Drunk», die ihren Alkoholpegel ständig hoch halten, damit sie nie recht Tritt fassen können. Allesamt ahnen sie, dass es sich mit zerrütteten Nerven und unsicherem Schritt doch besser lebt, als wenn alle Fragen geklärt sind. Wie abgründig nämlich das Gegenstück zur neurotischen Verunsicherung wäre, hat uns Alfred Hitchcocks «Vertigo» ein für alle Mal vorgeführt: Dessen Hauptfigur, der an Höhenangst leidende Privatdetektiv Scottie, geht in seinem Versuch, das Rätsel einer mysteriösen Frau zu ergründen, durch den Nervenzusammenbruch hindurch und schliesslich so weit, bis von seiner ganzen Umgebung nur noch tote Masken bleiben, mit nichts dahinter, wonach sich zu fragen lohnt. Jenseits des neurotischen Getriebenseins wartet nur noch depressiver, ja psychotischer Zerfall – und der angebliche Held ist nichts als ein Zombie, von sämtlichen Unsicherheiten befreit. Wer wollte so etwas wollen?
Johannes Binotto ist Kultur- und Medienwissenschaftler an der Hochschule Luzern und der Universität Zürich, Videoessayist und freier Autor; er lehrt, schreibt, forscht und filmt zu Film, Theorie und Technikgeschichte. www.medienkulturtechnik.org
 Heute
Heute