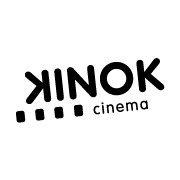Zum 75. Geburtstag von Wim Wenders
Wanderer zwischen den Welten
von Pamela Jahn
Es gibt viele gute Gründe, die Filme von Wim Wenders immer wieder neu auf der Leinwand zu entdecken. Seine bildgewaltigen Landschaftspanoramen gieren geradezu nach der Weite eines Kinosaals, so wie seine Protagonisten sich nach der Ferne sehnen, in die es sie oftmals bewusst oder unbewusst hinauszieht. Und nicht nur sie. Auch Wenders selbst ist ein Wanderer und Weltenbummler, im eigentlichen wie im übertragenen Sinn. Zu Beginn seiner Laufbahn zog es ihn zunächst zur Malerei, bis er über die Fotografie den Weg zum bewegten Bild fand. Begleitet wurde Wenders dabei stets von der Musik, die in seinem Werk bis heute eine tragende Rolle spielt. Als herausragender Vertreter des Neuen Deutschen Films schaffte er 1977 den Sprung nach Amerika – den Sehnsuchtsort seiner Filme. Dort spürte er den Songs von Bob Dylan, The Kinks oder Van Morrison nach und begab sich auf die Suche nach Bildern. In Roadmovies wie «Paris, Texas» (1984) oder «Don’t Come Knocking» (2005) hinterfragte er den Mythos USA und führte die amerikanischen und europäischen Filmtraditionen zu einem ganz eigenen Stil zusammen, der bis heute seinesgleichen sucht. Atmosphärische Momentaufnahmen und feinsinnige Reflexionen verdichtet er zu anspruchsvollen Arbeiten über einsame Menschen auf der Sinnsuche und ihre subjektiven Realitätserfahrungen. Wenders’ Werk lebt von einer Magie des Erzählens, die in und zwischen den Bildern zum Ausdruck kommt. All das verlangt nach einer Kinoleinwand, braucht Grösse und Weite, um zu atmen, zu wirken und zu sein.
Seit fast fünf Jahrzehnten zählt Wim Wenders zu den bedeutendsten Autoren des Gegenwartskinos. Als Filmpoet und Landschaftsmaler in einem nimmt er vor allem unter den deutschen Regisseuren eine besondere Stellung ein. So eigenwillig wie seine Filme ist auch er selbst von Anfang an gewesen, der ewig Reisende, stets seinen eigenen Weg suchend, immer neugierig auf neue Orte, neue Bilder, neue technische Möglichkeiten. Sein Kino ist der Schule eines Sehens verpflichtet, die voraussetzt, dass man sich Zeit lässt und gewillt ist, sich dem Moment hinzugeben, um dem Gesehenen tatsächlich nahe kommen zu können.
Wim Wenders, so viel steht fest, ist kein Freund der schnellen Bilder. Im Gegenteil. Der grosse Visionär bittet um Geduld. Das zeigt sich vor allem in der Art seines Erzählens, oder besser gesagt: des Nichterzählens. Denn die Bilder sind bei Wenders nicht vorrangig Mittel zum Zweck einer vorformulierten Geschichte. Oftmals erzählen sie genau von dem Unsagbaren und dem Unsichtbaren. Mit ihren langen, ruhigen Einstellungen, den dokumentarischen Kamerabewegungen und sorgfältig arrangierten Montagen plädieren seine Filme für das bewusst Rohe, Unfertige, Offene und Provokative. Das Wesentliche steckt wie so oft im flüchtigen Detail, in den unzähligen Bildern voller Bedeutung und Poesie, die diese freie Form des Erzählens mit sich bringt, durch nichts gerechtfertigt als durch eine schier endlose Neugier im Blick – und am Leben, wie es ist.
Für einen Regisseur, der sich so viel Zeit zum Sehen nimmt, ist es geradezu erstaunlich, dass es der gebürtige Düsseldorfer, der am 14. August seinen 75. Geburtstag feiert, im Laufe seiner Karriere auf über 50 Filme geschafft hat. Zumal der aus konservativ-katholischem Elternhause stammende Sohn eines Chirurgen zunächst eigentlich Priester werden wollte, dann Medizin studierte, kurze Zeit später zur Philosophie wechselte und schliesslich zur Soziologie, bis er das Studium 1966 ganz aufgab und nach Paris ging, um sich der Malerei zu widmen. Dort angekommen, verbringt er seine Zeit jedoch zunehmend in der Cinémathèque française, schaut bis zu fünf Filme am Tag und entdeckt seine grosse Liebe für das amerikanische Kino, das bald ein Leitmotiv für sein Schaffen insgesamt werden soll. Ein Jahr später kommt Wenders entschlossen nach Westdeutschland zurück, um ein Studium an der Universität für Film und Fernsehen in München aufzunehmen und diesmal auch abzuschliessen. Daraufhin stürzt er sich in die Arbeit, dreht sogleich drei Filme, doch erst der vierte, «Alice in den Städten» (1974), in dem er den Journalisten Philip Winter auf eine falsche Fährte bis in die Untiefen der USA schickt, um ihn am Ende mithilfe eines kleinen Mädchens zu sich selbst finden zu lassen, legt den entscheidenden Grundstein seines weiteren filmischen Werdegangs. Roadmovies sollen es von nun an sein, immer wieder, irgendwo. Und wenn ein Film mal nicht das unmittelbare Reisen beschrieb, durchzog ihn stets jene ungestüme Lust auf Neues, aufs Entdecken, das dem Unterwegssein eigen ist.
Schon bei seinem ersten Besuch im Land der unbegrenzten Möglichkeiten 1974 anlässlich der US-Premiere seiner ersten Handke-Verfilmung «Die Angst des Tormanns beim Elfmeter» (1972) bekommt Wenders vor Neugier kein Auge zu. Und wie so viele seiner Filme untersucht bereits dieser den unaufhaltsamen Einfluss der amerikanischen Kultur auf das zerrüttete Nachkriegsdeutschland, in dem Wenders aufgewachsen war. In Amerika, sagt Wenders selbst, habe er das erlebt, wovon die Helden in «Falsche Bewegung» (1975) und «Im Lauf der Zeit» (1976) nur geträumt haben. Nur sollte ihn Hollywood, insbesondere eine zutiefst gescheiterte Zusammenarbeit mit Francis Ford Coppola, bald auch das Fürchten lehren. Als er sieben Jahre später nach Deutschland zurückkehrt, ist Wenders ein gebranntes Kind, ähnlich wie Travis, der einsame Streuner, der am Anfang von «Paris, Texas» (1984) durch die verlassene amerikanische Wüste streift, weil er sich sonst nicht zu helfen weiss, begleitet allein von Ry Cooders unvergesslichem Gitarrenscore und der stets atemberaubenden Kamera von Robby Müller, mit dem der Regisseur seit den Anfängen in München bis dahin alle seine Filme gedreht hatte.
Wenders hat über die Jahrzehnte auf seinen Abenteuerreisen durchs Autorenkino sowohl die Sonnenseiten wie die dunklen Schatten des Geschäfts hinter der Kunst kennengelernt. Misserfolge waren für ihn stets Wendepunkte, und genau das zeichnet den wahren Künstler in ihm aus: die unermüdliche Fähigkeit, sich immer wieder und überall neu zu erfinden. Seinen bisweilen verunglückten Werken konterte er jeweils mit Filmen, in denen er wie in «Der Stand der Dinge» (1982) das Filmemachen selbst zum Thema machte, um der eigenen Desillusion gegenüber sich selbst und dem Kino Herr zu werden. Und wenn er sich stets auf eine Sache verlassen konnte, dann auf sein fast unheimliches Gespür für Orte und weite Landschaften – seien es die Wüste in «Paris, Texas», die Mauer in «Der Himmel über Berlin» (1987) oder die Kleinstadt in «Don’t Come Knocking» – und dafür, wie man sie ins rechte Bild rückt. Zudem hat Wenders es stets verstanden, seine kreativen Ideen in anderen Künstlern und Künsten zu spiegeln und nach Querverbindungen zu suchen, wie beispielsweise mit der kubanischen Musik in «Buena Vista Social Club» (1999) oder dem modernen Tanz in «Pina»(2011), seine grandiose, in 3-D gedrehte Hommage an Pina Bausch und ihrem Wuppertaler Ensemble. Und das sind nur die sichtbarsten Überschneidungen, für die er in all seinen Filmen als Vermittler eintritt und die er in weiteren Dokumentarfilmen immer wieder erkundet hat.
Vielleicht bleibt der Schlüssel zu Wenders’ Filmen am Ende tatsächlich die Neugier, mit der er bis heute aufs Leben schaut, bei allem, was er tut. Seine jüngste Leidenschaft gilt dabei der 3-D-Kamera, die er seit dem Erfolg mit «Pina» eine Zeit lang gar nicht mehr aus der Hand legen wollte und gleich darauf auch seinen nächsten Spielfilm «Every Thing Will Be Fine» (2015) auf diese Weise drehte, um dem Bild mehr Tiefe und den Schauspielern in ihrer Umgebung mehr Präsenz zu geben. Die Landschaft, aber auch die Gedanken der Protagonisten rücken so auf geradezu magische Weise in den Mittelpunkt des Geschehens, dass man manchmal den Eindruck hat, Wenders habe von seiner Passion des Malens so viel ins Kino hinübergerettet, dass die Bilder bei ihm buchstäblich sprechen lernen. Aber genau das ist letztlich das Spannende an seinen eigensinnigen und oftmals überwältigenden Filmen, diese ganz private, kritische Form des Blicks, bei der man, wenn man ganz genau hinsieht, dem Regisseur beim Denken zuschauen kann.
Der Auteur selbst jedoch hält dagegen: «Menschen in aller Welt haben meine Filme gesehen, viele sind von ihnen geprägt worden, und einige der Filme sind zu Klassikern oder Kultfilmen geworden. Sie gehören daher ohnehin nicht mehr mir, sondern einem kollektiven Gedächtnis von Zuschauern jeden Alters und vieler Nationalitäten. Mein Traum ist es, dass mein Werk in Zukunft nur mehr sich selbst gehört, und damit eben allen.» Ein schöneres Geschenk könnte uns Wim Wenders zu seinem Jubiläum gar nicht machen.
Pamela Jahn ist Autorin und Filmjournalistin. Sie schreibt u.a. für das ray Filmmagazin, für Sight & Sound, FAQ und das Electric Sheep Magazine. Sie lebt in London und ist dort auch als Filmkuratorin tätig.
 Heute
Heute