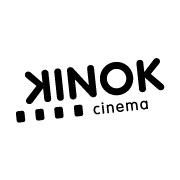Dynamo Kiew / Ein Tor für die Revolution
Mitw.: Miklos Gimes, Koni Frei, Röbi Wäschle, Giorgio Bellini, Filippo Leutenegger u.a.
«Dynamo Kiew» ist eine Hommage an die Spieler einer Fussballmannschaft, die eine der besten in Europa war. Während der siebziger Jahre – der Kalte Krieg war noch in vollem Gang – sorgte die Mannschaft, die aus dem Nichts kam, in Europa für einiges Aufsehen. Als erfolgreichster Fussballklub der Sowjetunion stiegen sie mit zwei internationalen Pokalen in die europäische Fussballelite auf. Die Traumelf mit Talenten wie Oleg Blochin liessen die Herzen der Sportjournalisten höher schlagen, die begeistert vom «Fussball des 21. Jahrhunderts» schrieben. Die Spieler des «Roten Orchesters» waren Stars und wurden in ihrer Heimat wie Helden verehrt. Heute sind sie um die fünfzig, aus ihrem Verein ist eine Aktiengesellschaft geworden. Einige der alten Fussballer kicken noch immer – in einer Veteranenelf. Die beiden Regisseurinnen verbinden spektakuläre Spielszenen aus den siebziger Jahren mit gefühlvollen Interviews der einstigen Spielern, die die ersten Popstars der Sowjetunion waren.
EIN TOR FÜR DIE REVOLUTION Regie: Christoph Kohler, CH 1993, 45 min.
Am 3. Oktober 1976 gründen Zürcher Linksaktivisten im Restaurant Cooperativo den Fortschrittlichen Schweizerischen Fussballverband FSFV. Wenn schon keine politische Revolution zu machen war, sollten wenigstens auf dem Fussballplatz fortschrittliche Ideale verwirklicht werden. Die Spielregeln des FSFV lauteten: Sitzstreik für alle Spieler! Frauen in den Sturm! Weg mit den Schiedsrichtern! «Ein Tor für die Revolution» verfolgt die Geschichte der ältesten alternativen Fussball-Liga der Welt von ihren Anfängen bis heute. Der wunderbare Film zeigt den Fussballplatz als Ort der Auseinandersetzung und der Emotionen, als Ort des gelebten Ideals, des Scheiterns und des gesellschaftlichen Wandels. «Trotz bescheidener Mittel ist ein weit über sportliche Aspekte hinausführendes Zeitdokument mit Lokalkolorit entstanden. Belebt wird das Archivmaterial durch Interviews mit Gründungsmitgliedern des Vereins: Einstige 68er und 80er Aktivisten, heute als Lokalinhaber, Steuerberater oder Psychotherapeuten tätig, konstatieren am Beispiel der Liga, was aus einstigen Idealen geworden ist.» NZZ
 Heute
Heute