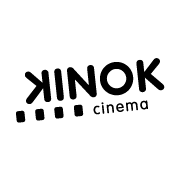El botón de nácar
Regie: Patricio Guzmán
Am Anfang steht ein 3000 Jahre alter Quarzblock, der einen Tropfen Wasser enthält. Dann folgen Bilder von Satellitenschüsseln, die im weltweit grössten Observatorium in der Atacama-Wüste stehen und Bilder des Weltalls liefern. Daraufhin hin erzählt die Off-Stimme Patricio Guzmáns zu Aufnahmen von wogenden Meereswellen von der existentiellen Wichtigkeit des Wassers. Später wird mit einer meterlangen Rolle Pappe, zurechtgeschnitten auf die Form Chiles, das Land mit seiner eigentümlichen geographischen Form erklärt. Anhand von Bildern und Gesprächen mit Ureinwohnern im Süden des Landes lernt man das Leben der einst hier ansässigen Völker kennen – und langsam entwickeln sich weitere Erzählstränge des Films, alle mit Bezug zum Wasser. Die Ureinwohner waren Nomaden des Wassers, umfuhren mit ihren Kanus die unzähligen Inseln, Felsen und Fjorde. Verblichene Schwarzweiss-Fotografien erzählen die Geschichte dieser Menschen, die im 19. Jahrhundert von Kolonisten ausgerottet wurden. Nur zwanzig von einst 8’000 Ureinwohnern leben heute noch, drei von ihnen kommen in «Der Perlmuttknopf» – was «El botón de nácar» auf deutsch bedeutet – zu Wort, und wie schon in seinem letzten Film «Nostalgia de la luz» schlägt Guzmán auch hier den Bogen zum Terror der Pinochet-Diktatur. «Guzmán ist ein weiser Filmemacher, ein Bilderpoet in der chilenischen Tradition der grossen politischen Cantos. Und ein raffinierter dazu. Diesmal betört er den Zuschauer zunächst mit einer Ode über die Rätsel des Wassers, aus dem die Menschen, die Erde und der gesamte Kosmos zu grossen Teilen bestehen. Er filmt die Dramatik der Brandung, die surreale Landschaft des patagonischen Insellabyrinths, das Ballett der Regentropfen, das Flirren des Lichts auf den Wellen. Er erkundet Eishöhlen, den Meeresgrund und die Wasservorkommen in fernen Galaxien. (…) Das Meer ist ein Wunder, ein Massengrab ist es auch. Guzmáns Film ist eine Zumutung im allerbesten Sinne: Das Schimmern des verwitterten Knopfs gehört zu den Bildern der 65. Berlinale, die bleiben.» Christiane Peitz, Der Tagesspiegel
 Heute
Heute