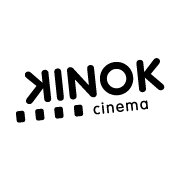Eine Verschmelzung aus Licht und Schatten
von Alexandra Stäheli
Die Welt fällt auseinander und die Menschen sind erschöpft, ausgelaugt vom Zusammenprall der Meinungen und Konzepte darüber, was nun richtig und gut sein soll. Sie möchten sich dem Schmerz, den der Zusammenbruch der alten Systeme in ihren Familien zurückgelassen hat, nicht stellen; sie möchten die sinnentleerten politischen Ränkespiele nicht mehr verfolgen und die Angst vor der Zukunft, die diese mit sich bringen, nicht mehr fühlen. Sie möchten viel lieber in künstliche Welten eintauchen, möchten Vergessen und Erleichterung finden in glitzernden Feierlichkeiten mit wilden Klängen und perlenden Champagnerpyramiden. Party bis zur Besinnungslosigkeit, Tanzen bis zum Koma. Scheinen uns diese Zeichen der Zeit irgendwie vertraut? Die Rede ist von den 20er-Jahren – des 20. Jahrhunderts. Jegliche Ähnlichkeiten mit den gerade anbrechenden 20ern sind rein zufällig und unbeabsichtigt.
Die berühmten Roaring Twenties, das war ein langer Rausch, der nach Ende des Ersten Weltkriegs mit den Verhandlungen um den folgenschweren Versailler Vertrag seinen Anfang nahm, den Aufstieg der NSDAP überdauerte und mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs jäh ein ernüchterndes Ende fand. Begleitet wurde dieser Taumel vom verlockenden Duft der Freiheit. Vor allem in den USA, wo die Zivilbevölkerung von den Folgen des Kriegs nicht so stark betroffen war wie die Menschen in Europa, brachte der zu Beginn der 1920er-Jahre einsetzende wirtschaftliche Aufschwung neue Konsumgüter hervor, die für ein unabhängiges und individuelles Leben standen. Die Autoindustrie boomte, und bereits jeder fünfte Amerikaner konnte sich damals ein Automobil leisten; die Frauen, zu neuem Selbstbewusstsein erwacht, schnitten ihre Haare, kürzten ihre Röcke, hielten Zigaretten mit langem Filter an ihre blutroten Lippen und enthüllten als kecke «Flapper» zu den wirbelnden Klängen des Charleston ihre Beine.
Dabei schien der Aufbruch ins Neue in Europa bzw. in Deutschland, wo die Weimarer Republik mit Wellen von Inflation und Arbeitslosigkeit zu kämpfen hatte, nicht ganz so ungebrochen vorwärts zu streben wie in den USA, wo erst der Börsencrash von 1929 dem Feiern ein abruptes Ende setzte. Die 1920er-Jahre, hält etwa der Philosoph Wolfram Eilenberger in seinem Buch «Zeit der Zauberer» fest, waren eine Zeit «enormer Desorientierung. Das sind immer gute Zeiten für das Denken». Für Eilenberger brach damals nach dem Ersten Weltkrieg «das letzte grosse Jahrzehnt der deutschsprachigen Philosophie» an, vertreten durch die Positionen von Ernst Cassirer, Martin Heidegger, Walter Benjamin und Ludwig Wittgenstein. So unterschiedlich die Herangehensweisen dieser vier Denker auch waren, in ihrem Kern beschäftigen sich ihre Werke, so Eilenberger, mit der in diesen unsicheren Zeiten brennenden, existenziellen Frage: «Was ist der Mensch?»
Und so weht auch durch viele deutsche Filme dieser Jahre eine gewisse existenzielle Schwere, ein Zweifel auch an den Qualitäten des Menschseins, die sich wie ein melancholischer Nebel um das quirlige Fluidum des Aufbruchs und des technisch-künstlerischen Fortschritts legen. Während der Expressionismus mit seinen rigoros ästhetisierenden Kontrasten von gut/böse, hell/dunkel, tot/lebendig und Licht/Schatten ein düsteres Netz aus Dualismen um seine Figuren webt, ein erbarmungsloses Entweder-oder-Spiel, das – wie das seltsam bipolare Lebensgefühl von Elend und Ekstase in der Weimarer Republik auch – keine Synthese, keine Versöhnung zulässt; während die Figuren des Expressionismus also ohne Hoffnung auf innere Entwicklung in einer dualen Welt erstarren, zeichnen die Filme der Neuen Sachlichkeit ein scheinbar nüchterneres, psychoanalytisch fundierteres Bild des Menschen, das sich letztlich jedoch als nicht minder pessimistisch enthüllt: Die Figuren, wie sie etwa durch Georg Wilhelm Pabsts Werke der 1920er-Jahre streifen, sind allesamt Mängelwesen, die ein unstillbares Begehren nach Besitz, Macht oder Anerkennung antreibt, an dem am Ende nicht nur sie selbst, sondern auch ihr Umfeld physisch, sozial oder moralisch zugrunde gehen.
Dabei sind es gerade die Frauen, die hier als treibende Kraft funktionieren und eine sehr zwiespältige Rolle auf der Leinwand und in den Geschichten spielen. Einerseits sind sie, wie die von der enigmatischen Louise Brooks verkörperte Lulu in «Die Büchse der Pandora» oder auch Lola Lola (Marlene Dietrich) in Josef von Sternbergs «Der blaue Engel», willensstarke, eigenständige Frauen, die sich in einer auf der Leinwand bisher nicht gekannten Freizügigkeit zeigen; andererseits scheinen genau diese zweifelhafte neue Freiheit und Macht sie ausweglos ins Verderben zu führen.
Was also ist der Mensch? Die Antworten, die die Filme der 1920er-Jahre auf diese Frage geben, sind vielfach zwiespältig. Auch für den 1935 geborenen Woody Allen, dem die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg in unzähligen Filmen als Inspirationsquelle für eine warme Gegenwelt zur aktuellen Realität dient, fällt die Antwort auf diese Frage zunehmend kulturpessimistisch aus: Der Mensch ist ein Flucht-Tier, das sich aus der grauen Gegenwart herausträumt und dabei, im Sog einer fernen Zeit, die wundersamsten Dinge erlebt. Allens Filme, ganz besonders die späteren, singen den Jazz des Eskapismus in den virtuosesten Tönen. Dabei zelebriert besonders der 2011 erschienene «Midnight in Paris» diese rückwärtsgewandte Romantik so poetisch und witzig wie selbstironisch.
Der erfolgreiche, aber innerlich nicht erfüllte Hollywoodautor Gil Pender (Owen Wilson) verbringt mit seiner Verlobten ein paar Tage in Paris und entdeckt in einer Seitenstrasse einen magischen Ort, der ihn direkt ins Paris der 1920er-Jahre führt – jene Zeit, nach der er sich am meisten sehnt. Wie Pender da F. Scott Fitzgerald und seine wilde Frau Zelda, den schweigsam-schüchternen Picasso und die Surrealisten trifft, die den Amerikaner aus der Zukunft neugierig bei sich aufnehmen und mit ihren sprudelnden Lebensweisheiten beschenken; wie Gertrude Stein mit strengem Blick sein erstes Romanfragment liest und sich Picassos Geliebte Adriana in Pender verliebt – dies alles erzählt Allen mit einer (in seinem Spätwerk seltenen) zauberhaften Leichtigkeit, die auch dann nicht weicht, als Pender erkennt, dass selbst die Menschen der von ihm so vergötterten Goldenen 20er-Jahre viel lieber in einer anderen Zeit gelebt hätten. Dass das Leben jedoch am meisten Spass macht, wenn man ganz in die Wirklichkeit seiner Zeit eintaucht, diese Erkenntnis trägt Pender letztlich aus seinem Parisaufenthalt davon und mit in ein neues Leben im Hier und Jetzt.
Eine ähnliche Lebenseinstellung scheinen die beiden Hauptfiguren in Jan Kounens Film «Coco Chanel & Igor Stravinsky» (2009) zu zelebrieren, in dieser Ode an die Vereinigung von Passion und Kreativität, in der sich Coco Chanel und Igor Strawinsky ganz den Strömungen ihrer Zeit hingeben. Dass sie in Kounens üppiger Inszenierung dabei fast von den Designikonen erschlagen werden, deren Grundlagen sie selbst gelegt haben, und die Figuren in der streng schwarz-weiss gehaltenen Farbkomposition fast schon zu einem eigenen Dekorelement werden, einem ästhetischen Kommentar über die Dualität und die Unvereinbarkeit ihrer beiden Lebenswege, ist nur eine Folge des Festes der Sinnlichkeit, dem sich Kounen verschrieben hat.
Schwarz/weiss, männlich/weiblich, Licht/Schatten, demokratisch/republikanisch, Freund/Feind, gesund/krank, Aufbruch/Erschöpfung, hilflos/rebellisch … Die Welt fällt auseinander und die Menschen sind erschöpft. Der Tanz der Gegensätze reisst uns heute in ähnlicher Weise mit, so scheint es, wie damals in den wilden 20er-Jahren. Sollte es uns helfen, die Frage nach dem Menschsein heute, ein Jahrhundert später, noch einmal in gleicher Weise zu stellen wie damals – aber mit neuen Antworten? Wie, wenn der Mensch nicht ein Mängelwesen wäre, sondern eines, das alles in sich verschmilzt, umfasst und aufnimmt? Licht und Schatten, hell und dunkel, Freund und Feind? Wie, wenn wir uns gar nicht entscheiden, sondern nur annehmen müssten, was immer schon da ist?
Alexandra Stäheli hat viele Jahre als Filmredaktorin bei der NZZ und an verschiedenen Kunsthochschulen als Dozentin für Filmtheorie gearbeitet. Heute ist sie Leiterin des Internationalen Künstler-Austauschprogramms Atelier Mondial in Basel und schreibt gelegentlich Texte über Kunst und Kultur für verschiedene Medien.
 Heute
Heute