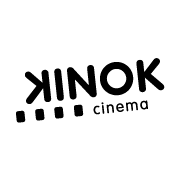Der Zirkusdirektor hinter der Kamera
von Gerhard Midding
Das Leben ist nicht vorbei, wenn seine Filme aufhören. Ihr Ende hält dessen Fluss nicht auf, sondern vertraut sich ihm an. Es respektiert dessen Energie und Weisheit. Als Schlusspunkt akzeptiert dieser Filmemacher nur den Tod; aber eigentlich nicht einmal ihn. Der Zirkus zieht weiter.
Federico Fellini hat einige der schönsten Filmenden der Kinogeschichte inszeniert. Diese Kunst beherrscht er bereits in den ersten Jahren seiner Regiekarriere. In «I vitelloni» verlässt Moraldo seine Heimatstadt, ist als einziger der Müssiggänger bereit, die eigene Trägheit zu überwinden. Er nimmt nicht Abschied von ihnen, dafür schwenkt die Kamera über die Gesichter der Schlafenden. Als sein Zug abfährt, ruft ihm ein junger Bahnangestellter enthusiastisch hinterher, gibt ihm Geleit für seine Flucht in die Zukunft. Am Ende von «Le notti di Cabiria» ist Cabiria, die tapfere Hure mit Clownsgesicht und Ringelsöckchen, von ihrem Verlobten so schäbig verraten worden, dass es einem das Herz zerreisst. Denkt sie daran, sich umzubringen? Plötzlich gerät sie in eine feiernde Menschenmenge. Erst fühlt sie sich verloren darin; nach Fröhlichkeit ist ihr nicht zumute. Aber dann lässt sie sich anstecken von der Ausgelassenheit der Welt und zaubert ein Lächeln auf ihr Gesicht. Unvergesslich ist auch das Lächeln des Mädchens am Strand in «La dolce vita», das sich mit Guido nicht verständigen kann. Sie verkörpert eine Unschuld, die der Gesellschaftsreporter endgültig verloren glaubt. In ihrem Blick liegt ein unfassbar reifes Einverständnis mit dem Lauf der Dinge. Die Zukunft liegt ihr zu Füssen.
Um Filme in solch beglückender Melancholie ausklingen zu lassen, braucht es einen Regisseur, der wachsam ist gegenüber der eigenen Sentimentalität. Da hilft es, wenn man wie Fellini in einem Küstenort geboren wurde, in Rimini, und aufgewachsen ist im Wechsel von sommerlicher Euphorie und winterlicher Tristesse. Seine Kindheit und Jugend sind eine Schatzkiste, aus der seine Filme unaufhörlich schöpfen. Fellini ist Moraldo, der als einziger der vitelloni ausbricht aus der provinziellen Enge. Dieser Regisseur erzählt in der ersten Person Singular, lässt sein Publikum teilhaben an seinen Träumen und Sehnsüchten, seinen Zweifeln und Krisen: furchtlos und voller Zuversicht, dass sie die Kinogänger etwas angehen. Er zählt zu den wenigen Filmemachern, deren Name zum Adjektiv geworden ist. Sein filmischer Kosmos ist augenblicklich erkennbar. In ihm herrscht eine Harmonie der Gegensätze. Er ist bevölkert von Frauengestalten mit ausladenden Kurven, aber auch zarten Gestalten wie seine Gattin Giulietta Masina, die so anrührend spielt wie eine sprechende Pantomimin. Schönheit und Monstrosität haben gleiches Bleiberecht im barocken Wirrwarr der Figuren, der anknüpft an die Tradition der grotesken Commedia dell’arte. Fellini betrachtet die Gesellschaft wie eine exotische Fauna, die ihn in Staunen versetzt und der er zugleich selbst angehört. Dass Marcello Mastroianni in «Otto e mezzo» sein Double spielt, hätte man auch ohne den Fellini-Stetson gemerkt, den er als Regisseur in der Schaffens- und Lebenskrise trägt.
Zu diesem Zeitpunkt, 1963, ist Fellini selbst zum eigentlichen Star seiner Filme geworden. Nach dem sensationellen Erfolg von «La dolce vita» 1960 ist er ein Markenzeichen. Sein Name taucht auf Plakaten nicht nur über dem Filmtitel auf, sondern wird selbst zum Bestandteil der Titel. Seine Dreharbeiten inszeniert er als Medienereignisse, setzt sich mal als strengen Verführer oder vergnügten Feldherrn in Szene, und immer wieder als Zirkusdirektor, dem das Spektakel diebisches Vergnügen bereitet.
Für Produzenten muss er ein Albtraum gewesen sein. Er kannte keine Schuldgefühle, wenn er deren Geld mit vollen Händen ausgab. Meist bekamen sie es zwar zurück, schliesslich war er weltweit ein zuverlässiger Gefühlswert an den Kinokassen. Aber seine Geldgeber mussten sich ihm mit Kopf und Kragen ausliefern. «Das Furchtbare ist», klagte sein französischer Co-Produzent Daniel Toscan du Plantier einmal, «dass er nie erzählt, wovon der Film handelt.»
Das wusste er oft selbst vor Drehbeginn noch nicht so genau. Jeder Film war eine Wette, ob es gelingt, dem Unbestimmten – einem Traum, einem Bild, einer Atmosphäre oder Laune – eine prächtige filmische Form zu verleihen. Obwohl er mit einigen der besten Szenaristen Italiens arbeitete (Ennio Flaiano, Tonino Guerra, Tullio Pinelli), besassen Drehbücher für ihn keine Verbindlichkeit. Sie waren keine Blaupausen, sondern luftige Entwürfe. Das Leben, vor allem aber seine Fantasie durfte, ja sollte dem Plan in die Quere kommen. Drehbücher, sagt er einmal, seien wie Koffer, die man erst während der Reise packt.
Er kultiviert das Image eines heiter Getriebenen, der sich gehorsam, ja demütig, in den Dienst seiner Phantasmagorien stellt. Zeit seiner Karriere hält er ihnen beharrlich die Treue. Aber seine Grösse liegt darin, die Opulenz des Lebens und seiner Fantasie gleichsam in einem Dressurakt zu bändigen. Er versteht es, dem Chaos eine Ordnung zu geben. Die Kamera steht bei ihm immer genau da, wo sie stehen muss.
Mit «La strada» und «I vitelloni» löst er sich resolut aus dem Schatten des Neorealismus (in dem er selbst als Drehbuchautor Rossellinis angefangen hat). Das lyrische Gespür für Schauplätze bewahrt er sich jedoch vorerst. Seine visuelle und erzählerische Vorstellungskraft scheint keine Grenzen zu kennen. Aber seine Inspiration hat stets Wurzeln in der Realität. Das gestrandete Meeresungeheuer, mit dem Marcello Mastroianni am Ende von «La dolce vita» stille Zwiesprache hält, geht auf eine Meldung aus den Vermischten Nachrichten zurück, die bereits die Fantasie des 14-jährigen Federico anregte: 1934 wurde am Strand von Rimini ein Monstrum angeschwemmt, das sich später als ein riesiger Seestern entpuppte. Es sucht sein Kino heim, taucht in der Gestalt des erlegten Wals in «Satyricon» auf oder als das schwermütige Nashorn, das in Ketten an Bord des Passagierdampfers in «E la nave va» gehievt wird.
Seit «I vitelloni» arbeitet er unermüdlich an der Neuerfindung seiner Erinnerungen. In «Roma» und erst recht in «Amarcord» gewinnen sie mythische Dimensionen. Die Hauptstadt, die sein junges Alter Ego 1939 entdeckt, weigert sich in «Roma» noch, Metropole zu sein. Nachts werden Schafherden durch die Innenstadt getrieben. (Hörte Carlo Levi hier nicht zu später Stunde das Gebrüll von Löwen?) In Fellinis Erinnerung ist Rom eine Ansammlung von Nachbarschaften, in denen eine anarchische Lebenslust herrscht – jeder ist hier ein Feinschmecker, Sänger oder Unruhestifter –, die gedeiht unter der Fuchtel von Faschismus und katholischer Kirche. Die vermeintlich dokumentarische Gegenwartsebene, in der Fellini sich selbst bei Dreharbeiten filmt, ist nicht minder ein Traum von Realität. Seit «Le notti di Cabiria» inszeniert er die Stadt als Hort der Ungleichzeitigkeit, wo der mondäne Glanz des Zentrums koexistiert mit der Armut der Vorstädte. Ein ewiger Schwebezustand: Die Historie gehört untilgbar zu ihrem Antlitz; die Tunnelbauer stossen alle hundert Meter auf Überreste der Antike.
Die Stadt erscheint ihm zusehends als eine Studiokulisse, und er wundert sich, dass sie noch nicht abgerissen wurde wie ein ausgedientes Dekor. Mit «Amarcord» vollzieht er 1973 den Abschied von Realschauplätzen. Das Kino wird für ihn fortan zu einer Atelierskunst. Das legendäre Teatro 5 in Cinecittà dient ihm als Festung seiner erzählerischen Gespinste. Hier kann er ungestört zum Weltenerfinder werden.
Mit «La dolce vita» trifft er 1960 den Nerv der Zeit. Er ist empfänglich für das, was in der Luft liegt: die sozialen Umbrüche im Italien der Nachkriegszeit; den Boom, mit dem eine moralische Desorientierung einhergeht; schliesslich das Spannungsfeld zwischen einer atemlos sensationsgierigen Öffentlichkeit und einem sich überschlagenden Kult der Berühmtheit.
Auch als er sich in Cinecittà verschanzt, hört Fellini nicht auf, ein Zeitgenosse seines Publikums zu sein. «Satyricon», dieses Pandämonium der Lüste, mag zwar in der Antike spielen, eröffnet aber der Gegenwart mannigfache Resonanzräume. Die freizügige Petronius-Adaption ist ausserordentlich populär bei amerikanischen Hippies; vielleicht nicht zuletzt deshalb, weil der Regisseur auf eine gewisse Demokratisierung des Erzählens zielt: Bekannte Schauspieler treten gleichberechtigt neben Darstellern auf, die er auf der Strasse findet.
Fellini gilt als Prototyp eines Künstlers, der sich exklusiv seinem eigenen Universum verpflichtet fühlt. Das bedeutet nicht, dass er sich jeglicher gesellschaftlichen Verantwortung enthoben glaubt. «La città delle donne» stellt 1980 Fellinis persönliche Auseinandersetzung mit der Frauenbewegung dar. Und «Ginger e Fred» mutet auf den ersten Blick zwar wie eine nostalgische Ausschweifung an. Tatsächlich jedoch setzt Fellini die beissende Medienkritik fort, die bereits «La dolce vita» auszeichnet: Noch vor Beginn der Berlusconi-Ära ahnt er die Schrecknisse des italienischen Privatfernsehens voraus. «Prova d’orchestra» schliesslich ist 1978 lesbar als Allegorie auf die politischen Verhältnisse in Italien. Die haben sich, wenn man es recht bedenkt, seither nicht nennenswert verändert.
Gerhard Midding ist freier Filmjournalist und lebt in Berlin. Er arbeitet für Tageszeitungen, Fachzeitschriften und Rundfunk und hat als Autor, Herausgeber oder Übersetzer an zahlreichen Filmbüchern mitgewirkt.
Der zweite Teil der Fellini-Retrospektive folgt im Februar.
 Heute
Heute