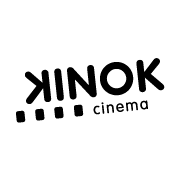Romy Schneider – Die Ungreifbare
von Cosima Lutz
Es gibt ein schönes Foto von den Dreharbeiten zu «Une histoire simple» aus dem Jahr 1978, darauf steht Romy Schneider leicht zurückgelehnt vor ihrem Regisseur, Claude Sautet. Beide, im Profil, schauen konzentriert in dieselbe Richtung: er mit wachem, ernstem Blick, sie lächelt skeptisch amüsiert. Seine rechte Hand greift Schneiders rechten Oberarm, als wolle er die Schauspielerin festhalten, als dürfe sie nur ja nicht umfallen oder fliehen. Wenn man aber genauer hinsieht, erkennt man, dass er nur drei Finger vorsichtig an ihren Arm gelegt hat. So kann keiner einen Menschen festhalten, nur erspüren, wohin er sich bewegen will, und ihn lassen.
Dass sie immerzu weg wollte, weg von ihrem Sissi-Image, weg von der Dominanz ihrer Mutter und den Übergriffigkeiten ihres Stiefvaters, weg von den eifersüchtigen, sie als «Franzosenflittchen» beschimpfenden Deutschen, sogar weg vom Film, immer wieder weg, auch von den Journalisten, denen sie zugleich ihr Privatestes anvertraute: Dieses sehnend Wegstrebende und Panische wurde zur alles bestimmenden Erzählung über ein Leben, das 1982, da war Romy Schneider erst 43 Jahre alt, allzu früh endete. Das «Tragische» ihrer Existenz hält bis heute den Mythos Romy lebendig und dominiert ihn gleichzeitig. Vor lauter Leben, Schmerz und Tod droht jedoch die Künstlerin Romy Schneider aus dem Blick zu geraten, die humorvolle und schöpferische, die sie auch war.
Als «süsses Mädel» mit vierzehn hatte sie an der Seite ihrer Mutter Magda Schneider in «Wenn der weisse Flieder wieder blüht» debütiert; von da an ging es in hoher Kadenz weiter. 1955 drehte Ernst Marischka mit ihr den ersten der drei Sissi-Filme. Wenig bekannt ist, dass sie bereits nach dem ersten Teil genug von der «Traumkaiserin» hatte. Ihre Einwilligung in den zweiten Teil machte sie abhängig davon, mit Josef von Báky «Robinson soll nicht sterben» drehen zu dürfen, wo sie «einmal ganz anders sein» und ein «zerlumptes, armes Mädchen» spielen wollte. Der Verleih stellte sich quer, «aber ich hatte mir die Zusage für ‹Robinson› schriftlich geben lassen und blieb zum ersten Male in meinem Leben hart». Ihre Entschlossenheit, ihr nach Süsskram verlangendes Publikum auch mal mit Charakterrollen zu irritieren, war von Anfang an da.
Sie hoffte schon mit abgeklärten 27 Jahren, dass ihre Nachwelt sich eines Tages für anderes als nur für ihr Privatleben interessieren würde, das allzu gerne mit ihren Rollen gleichgesetzt wurde. 1966 fragte sie der Regisseur Hans-Jürgen Syberberg, was ihrer Meinung nach jenseits von Sissi für die Leute interessant sein könnte an «Romy Schneider» – er spricht die Anführungszeichen mit, wissend, dass es sich bei der Schauspielerin, wie man heute sagen würde, um eine Marke handelt. «Ich weiss es nicht», antwortet sie, und es klingt nicht kokett, sondern ratlos. «Ich hoffe, dass man sagen wird: ihre Arbeit.»
Ihr hinterlassenes Werk ist viel disparater, als dass es mit der simplen Zweiteilung von Prinzessinnenkitsch einerseits und verruchter französischer Leinwandgöttin andererseits erfasst wäre. Womöglich gab es mehr Kontinuitäten als Brüche in ihrem Werk. Waren nicht schon in Géza von Radványis Film «Mädchen in Uniform» von 1958, der von der unschuldig stürmischen Liebe einer Internatsschülerin zu ihrer Lehrerin (Lilli Palmer) handelt, spätere Rollen vorgeprägt? Rollen, in denen unbändige Kraft und Verletzlichkeit zusammenfallen, wenn auch auf weniger laute, burleske Art? «Andere wurden zu Ikonen, das heisst, sie wurden starr», schrieb einmal Roger Willemsen und dachte dabei an Marlene Dietrich mit ihrem perfekt ausgeleuchteten Gesicht. Romy Schneider konnte und wollte sich, immer schon, auch gebrochen und brüchig zeigen.
Man wird ja bis heute nicht fertig mit diesem Gesicht, seinem Strahlen selbst dann, wenn es nur noch vom Erlöschen jeder Hoffnung erzählt. Liegt es an Schneiders «Begabung, Freude zu spielen», wie die Dokumentarfilmerin Ruth Beckermann einmal schrieb? An ihrer Anatomie? Die mädchenhaft gewölbte Stirn, die im Profil ähnlich verlaufende Wangenlinie und das weiche, leicht vorspringende Kinn bilden einen fast kalligrafisch schönen Rhythmus sanft schwingender Linien. Über ihre Augen, die schalkhaft und zugleich gütig blicken können, schrieb der Schriftsteller und Schauspieler Gregor von Rezzori, sie seien «eingebettet in die zarte Schwellung der Unterlider, die wie in einem innewohnenden, das ganze Wesen durchtränkenden Lächeln hochgezogen und aufgeworfen sind». Wende sich dieses Lächeln einem zu, so bewirke es «eine jähe Rührung und heftige Zuneigung, wie die runden und weichen Zutraulichkeiten junger Tiere».
Dieser altmodische, wie aus der Zeit gefallene Liebreiz war es, der sie in Frankreich zunächst zum keuschen Gegenmodell Brigitte Bardots machte. Es gibt ja nicht wirklich so etwas wie einen sexy Hüftschwung von ihr, stattdessen bewegt sie sich entweder kaum, sondern ruht, während um sie herum das Leben tobt, oder sie geht mit leicht abstehenden Ellenbogen und seltsam steifem Oberkörper durchs Bild, latscht und schwebt zugleich. Von Deutschland aus betrachtete man Schneiders Überlaufen zum einstigen Erzfeind mit Argwohn, erst recht, als sie eine Liaison mit dem Hallodri Alain Delon einging, mit dem sie später, als sie längst kein Paar mehr waren, in «La piscine» (1969) Sadomaso-Praktiken andeutete. Inmitten der Umbrüche um die sexuelle Befreiung und die beginnende Aufarbeitung der Nazizeit schwang sie sich zwar nie zur Wortführerin auf, doch sie gestand, unter der Hitler-Nähe ihrer Mutter Magda gelitten zu haben, und spielte in «Le vieux fusil» (1975), in Frankreich umjubelt, eine von SS-Truppen mit dem Flammenwerfer ermordete Französin.
Sie brauchte aber nicht einmal solch erschütternde Rollen, um einen ganzen Film unter Spannung zu setzen, wie jene der aus Not Pornofilme drehenden Schauspielerin in Andrzej Żuławskis «L’important c’est d’aimer» (1975), für die sie einen César erhielt. In Claude Millers Thriller «Garde à vue», entstanden ein Jahr vor ihrem Tod, tritt sie, nachdem lange nur über sie gesprochen wird, endlich dem Inspektor (Lino Ventura) und dem Publikum aus dem Schwarz einer Silvesternacht entgegen. Kalt und fast erstarrt erscheint sie da, und es genügen ein Heben der Augenbrauen und ein paar karge Sätze ihrer dunkel tönenden Stimme, um die Abgründe einer über Jahre gestorbenen Liebe brutal zu verdeutlichen – und doch zugleich unter Verschluss zu halten.
Die Gesichtsakrobatik, die sie etwa unter dem furchteinflössend eruptiv arbeitenden Luchino Visconti veranstaltete, steht im grössten Gegensatz zu ihrem reduzierten Mienenspiel besonders in den fünf Filmen mit ihrem Lieblingsregisseur Claude Sautet. An ihn wandte sie sich einst mit den Worten: «Ich hätte gerne, dass du eine Frauengeschichte schreibst, denn ich habe die Nase voll von den ewigen Männergeschichten.» Und Sautet schrieb ihr für «Une histoire simple» (1978) die Rolle einer unaufgeregt modernen Frau auf den Leib, die von angepasster Verzagtheit zu in sich ruhender, von sanfter Ironie umspielter Kraft findet. Für Sautet-Schneider, das wird auch in den vier anderen Filmen deutlich, die sie zuvor miteinander drehten, liegt das Geheimnisvolle gerade im Unspektakulären. Sautet sah in Romy Schneider die «Synthese aller Frauen», und das flösste ihm liebevollen Respekt ein. Nichts schien ihm ferner, als Pygmalion-gleich ein «Geschöpf» nach seinen Vorstellungen aus ihr zu formen.
Andererseits stand sich Romy Schneider beim Versuch, souveräne Autorin ihrer selbst zu werden, oft selbst im Weg, etwa wenn sie unter dem Einfluss ihres Macho-Gatten, des Theaterregisseurs Harry Meyen, geringschätzig von ihrer Arbeit sprach und verkündete, eine Frau müsse zu ihrem Mann aufblicken. Eine ausgeprägte Ambivalenz gegenüber der Schauspielerei, diesem ihr so lebensnotwendigen «Gift», verspürte sie allerdings schon als Schülertheater-Aktrice im Internat. Was sie wollte, ängstigte sie zugleich, sie litt unter Lampenfieber und darunter, nie eine solide Schauspielausbildung absolviert zu haben, und fürchtete die Leere und die Einsamkeit zwischen den Dreharbeiten. Niemand beobachtete sie so schonungslos wie sie sich selbst.
Und immer wieder rappelte sie sich auf. Ihr letzter Film, «La passante du Sans-Souci», für den sie sich den Regisseur Jacques Rouffio wünschte, ging auf ihre Initiative zurück. Darin gibt es einen Moment, der Schneiders Leidensfähigkeit ausstellt und zugleich ihre fast monströse Professionalität: Es ist ein Lächeln unter Tränen, als ein Junge im Alter ihres eigenen, tödlich verunglückten Sohns David Geige für sie spielt. Man muss die «wahre Geschichte» gar nicht kennen, um bis heute von diesem trauernden, über alle Massen liebenden Gesicht berührt zu sein.
Sie sei an «gebrochenem Herzen» gestorben, so interpretierten manche Zeitungen 1982 ihren Herztod und kolportierten auch Suizid. Dass sie Alkohol und Schlaftabletten zu sich genommen hatte, entsprach jedoch längst ihrer abendlichen Beruhigungs-Routine. «Aber der Tod war ihr willkommen. Sie hatte keine Kraft mehr», befand ihr Anwalt. «Ich bin fünfzig Filme», sagte sie einmal, halb stolz, halb verzweifelt über nie gelebten «Alltag». Vielleicht darf man versuchen, die allzu beengenden Zugriffe auf Romy Schneider ein wenig zu lockern, ganz so, wie Claude Sautet es auf dem Bild tut, und sie in ihren Filmen sein lassen.
Cosima Lutz studierte Theater-, Medien- und Filmwissenschaft, Neuere Deutsche Literaturgeschichte und Politische Wissenschaft in Erlangen und Wien und volontierte anschliessend bei der Tageszeitung «Die Welt» in Berlin. Neben ihrer Arbeit als freie Kulturjournalistin promovierte sie über das literaturwissenschaftliche Thema «Aufess-Systeme: Jean Pauls Poetik des Verzehrs». Nach Ausflügen zu Magazinen wie «GQ» und «Vanity Fair» schreibt sie unter anderem für «Die Welt», die «Berliner Morgenpost» und «Zeit Online» über Film, Kunst, Literatur und zeitgeschichtliche Themen.
 Heute
Heute