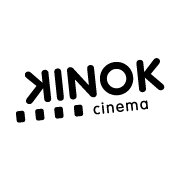Zum 100. Geburtstag von Éric Rohmer
Die Kunst der Fuge
von Gerhard Midding
Er liebte das natürliche Licht. Seinen Kameraleuten, später waren es vor allem Kamerafrauen, untersagte er, Scheinwerfer zu verwenden. Gespräche über die Liebe bei wechselnder Witterung einzufangen, war Éric Rohmer Schauwert genug. Das Wetter erfüllte vielfältige erzählerische Aufträge in seinem Kino. Es ist unbeständig wie die Gefühle. Es ist ein Element, dem man ausgeliefert ist und über das man keine Kontrolle hat. Er war sogar bereit, die ursprüngliche Reihenfolge seiner «Six contes moraux» umzustellen, um den nächsten Winter abzuwarten, bis sein Hauptdarsteller Jean-Louis Trintignant endlich für «Ma nuit chez Maud» frei war.
Dabei gehört Éric Rohmer zu den wenigen Filmemachern, deren Werk gleichsam einem Masterplan folgte: einem grossen und präzisen Entwurf des zyklischen Erzählens. Den von 1962 bis 1973 entstandenen «Contes moraux» liess er ab 1980 die «Comédies et proverbes» und ein Jahrzehnt später die «Contes des quatre saisons» folgen. Der erste Zyklus gehorchte streng einem Muster, das er in den weiteren kunstvoll verwandelte. In «Ma nuit chez Maud» und «Le Genou de Claire» hat er es besonders hinreissend ausformuliert: Ein eher humorloser Mann, der kurz davor steht, eine feste Bindung zu besiegeln, begegnet einer lebendigen, selbstbewussten Frau, die ihn so sehr bezaubert, dass er seine Entscheidung in Frage stellt. Der Einbruch der Spontaneität bringt die romantischen Gewissheiten ins Wanken, fungiert als eine heilsame, durchaus angstbesetzte Parenthese der Freiheit. Das Leben ist listiger als jede zurechtgelegte Strategie. Die Moral, die sein erster Zyklus im Titel führt, ist kein sittliches Prinzip, sondern eine Lehre, die sich aus der Erzählung ziehen lässt. Sie zeigt sich nicht in einem Urteil, sondern in der Anmut der Gedanken, Gesten und Worte.
Rohmer beherrschte die Kunst der Fuge. Auch Filme wie «Les Rendez-vous de Paris», die keinem Zyklus angehören, legte er beharrlich als Variation eines Themas an: dem Widerspruch zwischen Selbsttreue und Selbstbetrug. 1920 im südfranzösischen Tulle als Maurice Schérer geboren – der Legende nach ist sein Pseudonym eine Hommage an die bewunderten Krimiautoren Eric Ambler und Sax Rohmer –, war er gut ein Jahrzehnt älter (und auch weniger ungestüm) als seine Mitstreiter von der Nouvelle Vague. Er hatte bereits als Lehrer gearbeitet und 1946 unter dem Namen Gilbert Cordier den Roman «Elisabeth» geschrieben, bevor er 1951 als Kritiker zu den Cahiers du cinémastiess und im gleichen Jahr seinen ersten Kurzfilm drehte. In einem seiner meistbeachteten, mehrteiligen (schon damals dachte er in Serie!) Essays feierte er das Kino als letzte Zuflucht der Poesie. Seinen Kritikerkollegen blieb er ein Rätsel. Stets ging er allein ins Kino. Dass er verheiratet war (seine Frau hiess Thérèse), dürfte eines der am besten gehüteten Geheimnisse der Filmgeschichte sein.
Mit seinem atmosphärisch meisterlichen Langfilmdebüt «Le Signe du lion» legte er einen der Grundsteine der Nouvelle Vague, ja des modernen Kinos überhaupt. Es ist einer der schönsten Paris-Filme überhaupt und zeigt seine Vorliebe, auf den Strassen zu drehen. Fortan drehte er in fast jedem Winkel Frankreichs. Noch im hohen Alter bezeichnete sich dieser stolze Freischärler (und Aussenseiter im saturierten Produktionssystem Frankreichs) als einen ewigen Amateur. Seine Filme kosteten wenig, weil er meist nur mit einem achtköpfigen Team und vorzugsweise auf 16 Millimeter drehte. Auf Schauplatzsuche ging er selbst – und wenn einmal für eine Szene ein Duschvorhang fehlte, besorgte er ihn eigenhändig in der nächsten Filiale der Kaufhauskette Tati. Mit den Vorbereitungen begann er oft schon lange im Voraus. Die Rosen, die Béatrice Romand und Jean-Claude Brialy in «Le Genou de Claire» pflücken, hatte er ein Jahr zuvor pflanzen lassen, damit sie pünktlich zu Drehbeginn blühten. Rohmer kochte selbst für seine Mitarbeiter, meist vegetarisch. Die Co2-Bilanz seiner Produktionen muss mustergültig gewesen sein.
Diesen Entstehungsbedingungen ist eine eigene, unverwechselbare Ästhetik geschuldet. Sein Kino ist eines der Evidenz, das vorgibt, nichts zu verbergen. Ihm ist freilich ein weiterer Boden von Einfühlung und Distanz eingezogen, eine den Figuren zu- und dann wieder abgewandte, stets grosszügig liebende Ironie. Seine szenisch unaufwendigen, aber natürlich keineswegs unkomplizierten Liebesintrigen setzt er mit ausschweifender Schmucklosigkeit in Szene. Sein Stil will unsichtbar, aber nicht bloss funktional sein. Er filmt mit einem aufmerksamen Pointillismus, der nicht buhlen mag um die Aufmerksamkeit eines Publikums, das auf der Leinwand handfestere Sensationen erwartet. Rohmer interessiert weniger, was an äusserer Handlung passiert – wann ist seit «Les Nuits de la pleine lune» je wieder eine seiner Figuren ins Schwitzen geraten? –, sondern was in den Köpfen der Figuren vorgeht.
Er ist ein Regisseur des Wortlauts. Schon als Kritiker definierte er den Tonfilm als film parlant. Das Sprechen ist für ihn der aufregendste Akt überhaupt, dem die Kamera zuschauen kann. Liebe und Sehnsucht sind bei ihm ein Plan, der glücklich scheitert. Sie entfalten ihre filmische Aura endgültig erst in der Reflexion. Das Wort fungiert als Ersatz, Dopplung und Rekonstruktion. Die Konversation erscheint ihm als triftigstes Mittel, die filmischen Bedingungen der Wahrheit zu erforschen. Zu trauen ist der Rede freilich nicht. Dazu ist zu viel Selbsttäuschung im Spiel. Und nicht jedem, dem Rohmer das Wort erteilt, gibt er auch Recht: So bringt er nicht nur Ironie, sondern auch Weisheit ins Spiel. Auch wenn alles gesagt scheint, bleibt noch ein Geheimnis offen.
Dieser Stil lässt sich schwer imitieren, war gleichwohl aber überaus einflussreich: Das Werk Pascal Bonitzers, Rudolf Thomes oder des Koreaners Hong Sang-soo wäre ohne ihn nicht denkbar. Dass die Konversation im französischen Kino zu einer ganz eigenen, gar dominierenden Kategorie des Handelns werden konnte, ist vor allem Rohmer zu verdanken. Er war der einzige Regisseur der Nouvelle Vague, der nie einen Co-Autor brauchte. Zwar bestand er darauf, dass Darstellerinnen und Darsteller den Drehbüchern bis aufs Komma folgten. Aber das Wunder seines Schaffens besteht darin, dass er ihnen das Gefühl gab, sie würden die Dialoge selbst erfinden. Das gelang, weil er ihr Temperament einkalkulierte, empfänglich war für ihren verschmitzten Ernst und ihre Launen voller Esprit. Feinnervig fing bei ihm die Kamera das Timbre und die Nuancen in ihrem Spiel ein. Schönheit und Sinnlichkeit fing er ein wie ein unschuldiger Voyeur.
Vor zehn Jahren ist Éric Rohmer gestorben. Man kann kaum glauben, dass das so lange her sein soll. Er erscheint noch immer als unser Zeitgenosse, gehörte noch lange dem neuen Jahrhundert an, sein Werk ragte noch stolz in dieses hinein. Bis zuletzt unterrichtete er unter seinem Geburtsnamen Maurice Schérer. Die Alterslosigkeit und Frische seines Kinos ist ein prächtiges Rätsel. Kommt man ihm auf die Spur, wenn man feststellt, dass er sich stets neu erfinden konnte? Mit «L’Anglaise et le duc» agierte er 2001 sogar noch einmal als Pionier: Es war einer der ersten Filme, die in Frankreich mit einer Digitalkamera gedreht wurden.
Diese verleiht den Konturen einen Schimmer von Klarheit und Gegenwärtigkeit. Dabei erzählt Rohmer ein intimes Historiendrama aus der Zeit der Französischen Revolution. Er erschliesst sich die Epoche aus einer vermeintlich unpatriotischen Perspektive: dem Blickwinkel der schottischen Aristokratin Grace Elliott, deren Memoiren «Journal of My Life During the French Revolution» sie als aufgeklärte Royalistin und eigenwillige Zeitzeugin ausweisen. Die Titelfiguren, die frankophile Schottin und der Herzog von Orléans, waren einst ein Liebespaar; nun haben sie ihre Leidenschaft in eine erbauliche Freundschaft gerettet, in ein nach wie vor verschlungenes emotionales Band. Er ist der Cousin des Königs, zugleich aber überzeugter Republikaner. Sie ist eine anteilnehmende, scharfe Kritikerin seines Taktierens. Der Regisseur bleibt sich treu, treibt ein komödiantisches Spiel mit These und Antithese. Wiederum eine moralische Erzählung!
Aber zugleich nimmt er mit Elan die tückische Herausforderung an, das revolutionäre Paris zu vergegenwärtigen, seine Panoramen, Gebräuche und den Alltag frisch zu entfalten. Die Figuren bewegen sich in gemalten Aussenszenerien (in den Nahaufnahmen sind die einzelnen Pinselstriche noch zu erkennen), die der Maler Jean-Baptiste Marot zeitgenössischen Vorlagen nachempfunden hat. Das ist eine anfangs distanzierende, gleichwohl triftige topografische Anverwandlung. Rohmer filmt keine historischen Stillleben, sondern knüpft an die alte Tradition der tableaux vivants an, der zum Leben erweckten Bilder. In seinem schönsten Kostümfilm beweist Rohmer seine einzigartige Gabe, sich in vergangene Epochen einzufühlen. Diesmal kann er gar mit einem waschechten Suspense aufwarten. Schliesslich gilt es, seine Figuren vor der Guillotine zu retten.
Gerhard Midding ist freier Filmjournalist und lebt in Berlin. Er arbeitet für Tageszeitungen, Fachzeitschriften und Rundfunk und hat als Autor, Herausgeber oder Übersetzer an zahlreichen Filmbüchern mitgewirkt.
 Heute
Heute