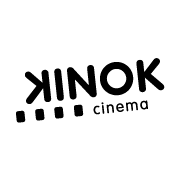Top Secret
von Johannes Binotto
Das 19. Jahrhundert war das Jahrhundert des Detektivs. Der Held der Moderne hingegen ist Geheimagent und sein Medium der Film. Der Detektiv, das war die literarische Figur par excellence, weil er auch selbst nichts anderes machte, als andauernd zu lesen: Spuren, Indizien. Sherlock Holmes konnte bekanntlich noch ganze Fälle lösen, ohne überhaupt aus seinem Sessel aufzustehen und war damit die ideale Identifikationsfigur für Leseratten. Filmisch gibt dies wenig her. Der Geheimagent hingegen ist immer unterwegs, always on the run, sei es auf der Flucht oder auf der Jagd. Mit dem durch seine vorgesetzte Behörde verordneten Bewegungsdrang ist er geradezu geschaffen für die bewegten Bilder, die ebenfalls nie zur Ruhe kommen. Der Film, der mit nur einem Schnitt von London nach Hongkong und von Washington nach Moskau springt, ist des Agenten zweite Natur, und die ausgeklügelten Utensilien, die er im Ausrüstungskoffer mit sich führt, stehen letztlich für nichts anderes als das beste Gadget überhaupt: die Filmtechnik, die alles möglich macht.
Kein Wunder also, dass auch Ian Flemings James Bond erst so richtig Furore machte, als er 1962 mit dem Film «Dr. No» vom Roman- zum Leinwandhelden aufstieg. Die tief wurzelnde Affinität des Kinos für Agentenstories hatten da andere freilich schon längst erprobt. Bereits 1928 dreht Fritz Lang seinen Stummfilm «Spione» und etabliert dabei eine Unzahl jener Elemente, für die man auch die späteren Agentenfilme lieben wird. Haghi, der Oberschurke in Langs Film, ist ein Grössenwahnsinniger im Rollstuhl, mit perversen Gelüsten und den Händen immer an Schaltern und Hebeln, um ausgeklügelte Maschinerien zur Lebensvernichtung zu betätigen. Wer wird darin nicht Bonds ewigen Gegenspieler Ernst Stavro Blofeld und dessen bizarre Welteroberungsfantasien wiedererkennen? Dass die Bondfilme bis heute immer auch ein Spiegelbild der aktuellen politischen Situation sind, findet sich bereits in Agentenfilmen wie Carol Reeds «The Third Man» vorgeführt, in dem sich der verschlagene Schieber Harry Lime durch das kriegsversehrte und von Siegermächten besetzte Wien von 1949 mogelt. Alfred Hitchcock schliesslich, der mit «Foreign Correspondent» schon einen cleveren Spionagefilm gedreht hatte, liefert mit «North by Northwest» die Anleitung, mit welcher Eleganz in Zukunft das Agentengeschäft zu betreiben ist. Sein Held, der unglückliche Werbefachmann Roger Thornhill wird zwar nur aus Versehen für einen Geheimdienstler gehalten, doch selbst in der unfreiwilligen Rolle macht er eine weit bessere Figur als sämtliche Bonds nach ihm. Hier wird gezeigt, wie man noch auf der wildesten Jagd Zeit findet, im luxuriösen Nachtzug eine kühle Blondine zu verführen (oder sich von ihr verführen zu lassen), um schon am nächsten Morgen wieder Kopf und Kragen zu riskieren, weil man von einem Flugzeug durch die Wüste gejagt wird. Und zwischen den aussergewöhnlichen Bewährungsproben trinkt der vermeintliche Agent Martinis – auch dieser Gewohnheit wird man später wieder begegnen. Kein Wunder, hatten die Bond-Produzenten Cary Grant, den Hauptdarsteller von «North by Northwest», zumindest zeitweilig im Visier für die Rolle des 007. Und Alfred Hitchcock wurde von Ian Fleming höchstpersönlich die Verfilmung eines Bondromans angetragen.
Doch wie die James-Bond-Filme nicht zu denken sind ohne die stimmungsvollen Agentenfilme von Lang, Reed oder Hitchcock, an die sie sich anlehnen und die sie zuweilen sogar explizit zitieren, so sorgen die Bond-Filme selbst für andauernde Inspiration. Dass die Hommage dabei mit Vorliebe parodistische Züge annimmt, ist schon bei den selbstironischen Bondfilmen mit Roger Moore angelegt, wie etwa dessen Meisterstück «The Spy Who Loved Me», ehe dann die Superagentenfigur in Filmen wie «OSS 117: Le Caire, nid d’espions» vollends durch den Kakao gezogen wird. In John Boormans «The Tailor of Panama» bringen ein abgehalfterter (notabene vom Ex-Bond-Darsteller Pierce Brosnan gespielter) Kleinspion und ein kleinkrimineller Herrenschneider die grosse Weltpolitik mit erfundenen Regierungsgeheimnissen in Aufruhr. Man wird das ungute Gefühl nicht los, dass vielleicht auch das reale Treiben der Geheimdienste immer nur eine Farce war – grausige Spiele von infantilen Männern.
Am fundamentalsten fällt die Dekonstruktion des Agenten in Philippe de Brocas Meisterstück «Le magnifique» aus, dieser ebenso klugen wie brüllend-komischen Persiflage auf alles, was dem Spion lieb ist. De Brocas Superagent Bob Saint-Clair, immer eine Zyankali-Kapsel im hohlen Zahn und eine Schönheit an seiner Seite, wird als blosses Konstrukt des abgerissenen Schriftstellers François Merlin entlarvt, der mit Schundromanen um den Übermenschen seinen mickrigen Lebensunterhalt verdienen muss und anhand der Romanfigur durcharbeitet, was im wahren Leben nicht funktioniert. Lassen die Handwerker einmal mehr auf sich warten, setzt sich der Autor hin und arbeitet sie in den neuesten Roman ein, wo sie gleich von Saint-Clairs Maschinengewehrsalven niedergemäht werden. Und natürlich ist auch die Nemesis des Agenten, der sadistische Globalverschwörer Karpof, keinem Geringeren nachgebildet als dem knausrigen Verleger des Schriftstellers. Superagenten wie Bond und Konsorten – so führt de Broca elegant und gewitzt vor – sind nichts als Ersatzfantasien für den verunsicherten Mann. Der Spion ist die strahlende Verkörperung männlicher Neurosen. Dieser Einsicht in die eigene psychische Versehrtheit können sich denn auch die ernstzunehmenden Agenten immer weniger verschliessen. Ethan Hunt mag in den «Mission: Impossible»-Filmen noch so schnell seinen Gegnern davonrennen, seiner eigenen Heimatlosigkeit entkommt er nicht.
Die Erkenntnis, dass das Agentenkino vielleicht immer schon Symptom männlicher Verunsicherung war, könnte auch der aktuellen Diskussion darüber, ob Figuren wie Bond überhaupt noch zeitgemäss sind, einen überraschenden Dreh geben. Wie die falsche Identität, die sich der Undercoveragent zulegt, ist auch die von ihm zelebrierte Stärke eine blosse Maskerade, und an der toxic masculinity, die er ausströmt, verbrennt er sich unweigerlich selbst die Finger. So wie der Kaiser mit seinen neuen Kleidern war auch Bond mit seinen neuen Gadgets eigentlich immer schon nackt.
Besser also, wenn Agentinnen das Ruder übernehmen wie in der Parodie «Spy: Susan Cooper Undercover», in der die von Melissa McCarthy gespielte CIA-Analystin Susan erfolgreich gerade biegen muss, was die angeblichen Superhelden verbockt haben. Und im Comic haben in der Spionage ohnehin schon längst die Frauen die Nase vorn: «Modesty Blaise», die Joseph Losey bereits 1966 vom Comicstrip in einen grellpoppigen Film übersetzte, oder Lorraine Broughton aus der Graphic Novel «The Coldest City», die jüngst als «Atomic Blonde» im Kino einschlug: Sie führen vor, was das Spionagekino noch bringt, auch dann, wenn es die Spione von einst schon längst nicht mehr bringen.
Johannes Binotto ist Kultur- und Medienwissenschaftler an der Hochschule Luzern Design & Kunst und der Universität Zürich und lehrt, schreibt und forscht zur Geschichte und Theorie des Films sowie dessen Schnittstellen zu anderen Künsten und Theorien. Seine Webseite lautet www.schnittstellen.me.
 Heute
Heute