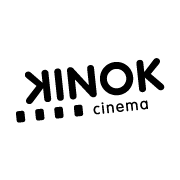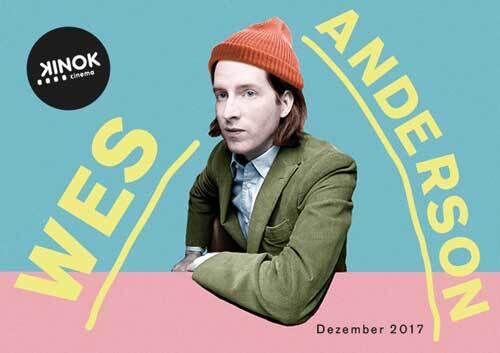
Gemeinsam im Setzkasten.
Zum Bilderbuchkino von Wes Anderson
Von Johannes Binotto
In alten Filmen sieht man das manchmal: Da geht eine Figur von einem Zimmer ins nächste, und die Kamera fährt mit. Doch der Filmapparat geht nicht etwa mit der Person durch die Tür, wie es sich gehören würde, sondern kurvt stattdessen um die Kulissen des Filmsets herum. Das wirkt, als wären die Räume des Films bloss Kammern in einem Puppenhaus, und das sind sie ja in Wirklichkeit auch. Wer schon einmal in einem Filmstudio war, der weiss: Filme macht man in einer Setzkastenwelt, die nach oben und vorne offen ist, damit man gut hineinschauen kann. Doch während Filme das gemeinhin zu verheimlichen versuchen, kann sich gerade dort eine besondere Magie entfalten, wo man die Künstlichkeit des filmischen Raums nicht kaschiert, sondern ausstellt. Einer, der das erkannt hat, ist der amerikanische Filmemacher Wes Anderson. Bei ihm findet man sie denn auch unentwegt, die filmischen Puppenhauswelten. In seinem Film «Moonrise Kingdom» gleitet unser Blick einem Haus entlang, ohne dass eine Aussenwand da wäre, die unseren Blick stören würde. So können wir gut sehen, was eine Familie des Abends in ihren verschiedenen Zimmern macht. Das ist, als hätte man einen Adventskalender vor sich, bei dem schon alle Türchen aufgeklappt sind, oder eines jener Bilderbücher, in denen man die Feuerwehrstation oder das Polizeigebäude im Querschnitt sieht. In «The Life Aquatic with Steve Zissou» wird Anderson denn auch die Aussenhülle des Forschungsschiffs Belafonte wegnehmen, damit wir einen besseren Überblick haben. Freilich wird man diesen trotzdem sogleich verlieren wegen all der vielen Details, die auf Andersons Filmbildern versteckt sind. Mit ihren vollgepackten Schauplätzen, wo es mit jedem farbigen Schnürsenkel und noch dem kleinsten Fitzelchen Tapete seine besondere Bewandtnis hat, möchte man jede einzelne Einstellung am liebsten rahmen und an die Wand hängen. Das detailverliebte Kino von Wes Anderson wirkt auf seine Zuschauerinnen und Zuschauer wie jene Wimmelbilder, die Kinder stundenlang bestaunen können, um dann bei jeder neu entdeckten Kleinigkeit leise zu kichern.
Tatsächlich liebt der Regisseur die kindliche Perspektive – im konkreten ebenso wie im übertragenen Sinn. Seine Erzählungen handeln allesamt von Söhnen und Töchtern, die selbst im Erwachsenenalter nie ganz ihren Kinderkleidern entwachsen sind, so wie Edward Norton, der in «Moonrise Kingdom» immer in Pfadfinderuniform herumläuft, oder Ben Stiller in «The Royal Tenenbaums», der auch als Vater noch denselben roten Trainingsanzug trägt wie seine beiden Söhne. Mögen die Grösseren auch bereits eigene Kinder haben, so sind sie doch Kindsköpfe geblieben, wie etwa der verschrobene Tiefseetaucher Steve Zissou, der seinen Vaterpflichten nicht nachkommen mag, sondern lieber Bubenträumen nachjagt. Auch als erwachsene Frau schleicht sich das einstige Wunderkind Margot Tenenbaum gern heimlich davon oder versteckt sich im Badezimmer, und der Fuchsvater im Animationsfilm «Fantastic Mr. Fox» kann das Stibitzen nicht lassen.
Im Gegenzug geben sich dafür die einsamen Kinder altklug und abgeklärt, tragen Mützen, Handtaschen und karierte Bademäntel, als wären sie bereits betagte Damen und Herren. Unübertroffener Held all dieser zwischen den Lebensaltern schlingernden Figuren ist zweifellos der fünfzehnjährige Max Fischer in Andersons Meisterwerk «Rushmore». Max ist Schülerzeitungsverleger, Französischklub-Präsident, Russland-Vertreter in der Kinder-Uno, Vorstand im Briefmarken- und Numismatikverein, Debattierklub-Kapitän, Gründer sowohl des Astronomie- wie des Völkerball-Teams, Fechter, Zehnkämpfer, Träger des gelben Judo-Gurtes, zweiter Chormeister und Präsident der Kalligrafie-Gruppe. Für die Hauptfächer aber fehlt ihm der Geist. Lieber bringt er den Vietnamkrieg oder Sidney Lumets Polizistendrama «Serpico» auf die Bühne des Schülertheaters. Auch um eine Lehrerin zu verführen, ist ihm kein Aufwand gross genug: Nachts steigt er bei ihr ein und bringt auch gleich eine Kassette mit französischen Chansons mit, um für die passende erotische Stimmung zu sorgen.
Doch so absurd, wie der hochtrabende Jungspund anmutet, ist er nicht. Zärtlich ruft uns der Regisseur in Erinnerung, dass wir alle in jugendlichem Alter unentwegt zwischen Grössenwahn und Depression pendelten. Unweigerlich kommen einem die langen, schulfreien Nachmittage in den Sinn, in denen wir als Halbwüchsige auf unseren bereits zu kleinen Kinderbetten lagen und von einem abenteuerlicheren Leben träumten und dabei doch nicht wussten, wie ein solches genau anzufangen wäre.
Obwohl wie von einem vorwitzigen Kind gemacht, sind Andersons Filme trotzdem nicht das, was wir unter Kinderfilmen verstehen. Die heitere Schwermut, auf die sich der Filmemacher so gut versteht, hat abgründige Ursachen. Die kuriosen Spleens der Charaktere sind Symptome einer versehrten Seele, und in «The Grand Budapest Hotel» lauert hinter der melancholischen Erinnerung an ein Ferienressort aus längst vergangenen Tagen nichts Geringeres als das Wissen um die Schrecken zweier Weltkriege. «Die Welt von gestern» hat der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig, dessen Erzählungen Andersons Film inspirierten, seine Memoiren genannt. Das könnte auch ein passender Titel für «The Grand Budapest Hotel» sein. Für Zweig freilich war die Erfahrung, jenes Europa der Vergangenheit im Wahnsinn des Nationalsozialismus untergehen zu sehen, derart erschütternd, dass er sich 1942 im brasilianischen Exil gemeinsam mit seiner Frau Lotte das Leben nahm.
Dieser Zug zur Depression ist auch Andersons Kino eigen, das bei aller Fröhlichkeit der überbordenden Inszenierung zugleich ein tieftrauriges ist. Nicht umsonst beginnen und enden diese Filme mit Vorliebe mit dem Tod geliebter Menschen, mit Verlusten, an denen die Figuren zu verzweifeln drohen. So erscheinen Andersons Helden und Heldinnen wie Brüder und Schwestern jenes lebensmüden, vaterlosen Harold aus Hal Ashbys «Harold and Maude», der mit Vorliebe seinen eigenen Tod inszeniert, dem aber eine alte Frau kurz vor ihrem Tod Liebe und Lebenslust lehrt. Gehört das grossherzige Aussenseiter-Kino von Hal Ashby ohnehin zu den zentralen Referenzen für Wes Andersons eigenes Werk, so dieser Film wohl ganz besonders. Bud Curt, der lange vergessene Darsteller von Ashbys Harold hat denn auch bei Anderson ein Comeback: als schüchterner Versicherungsagent Bill Ubell in «The Life Aquatic». Und so wie sich Harold bei Hal Ashby am Ende nicht umbringt, sondern im Schmerz zu tanzen beginnt, so liebt auch Wes Anderson seine Geschöpfe viel zu sehr, um sie in der Trauer um die Vergangenheit umkommen zu lassen. Stattdessen schenkt er ihnen die Gnade eines bittersüssen Happy Ends, bei dem von den Figuren abfällt, was sie sonst niederdrückt, wie bei den drei Brüdern in «The Darjeeling Limited», die ihr Gepäck wegwerfen, um doch noch den Zug des Lebens zu erwischen. In der Puppenhauswelt, wo die Häuser keine Wände haben und die physikalischen Gesetze nicht gelten, hat auch der Tod nicht das letzte Wort. So wird, wer genau hinschaut, im Schlussbild von «The Life Aquatic» auch jene Figur entdecken, die eben erst verstorben ist. Was uns in der schalen Realität versagt bleibt, darf in der Wunderwelt des Kinos nicht unmöglich sein.
Damit wird denn auch Wes Andersons Vorliebe für Bilderbuchwelten mit aufgeschnittenen Häusern noch einmal anders lesbar als nur als ästhetische Marotte. Wenn wir in seinen Setzkastenszenen die Personen alle gleichzeitig und doch jede für sich in ihren Kämmerchen sitzen sehen, dann drückt sich damit auch eine Haltung dem Leben gegenüber aus, die eingesteht, dass wir alle einsam sind, allein gelassen in unserer individuellen Verletztheit, und die zugleich doch daran glaubt, dass wir gerade in unserer Eigenheit eine Gemeinschaft bilden. Sei es das Personal eines Hotels, die Besatzung eines Schiffs, die Zöglinge einer Schule – sie alle halten zusammen, obwohl doch jeder und jede einzelne von ihnen ein bindungsgestörter Freak ist. Selbst die böse, durchgeknallte Ratte in «Fantastic Mr. Fox» gehört am Ende zur Gemeinschaft dazu und wird im Sterben von ihren vormaligen Feinden zärtlich gestreichelt. Und auf dem Plakat von «The Life Aquatic» sehen wir jene Szene gegen Schluss, wenn im Unterseeboot von Steve Zissou alle eng zusammenrücken, selbst jene, die sich vorher spinnefeind waren. In gemeinsamer, stiller Verwunderung schauen sie durch das Bullauge ihres Bootes nach draussen in die Tiefseewelt und blicken dabei auch zu uns in den Kinosaal, dorthin, wo wir sitzen, jeder und jede im eigenen Sitz und doch für die Dauer eines Filmes glücklich vereint. Wir alle, eine Gemeinschaft aus Verschiedenen.
Johannes Binotto ist Kultur- und Medienwissenschaftler an der Hochschule Luzern und der Universität Zürich, freier Autor und Redakteur des Filmbulletin, lehrt, schreibt und forscht zur Geschichte und Theorie des Films sowie dessen Schnittstellen zu anderen Künsten und Theorien.
 Heute
Heute