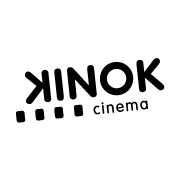Männer, die ins Auge gehen
Von Marli Feldvoss
«Dear Mr. Gable, you made me love you», singt die junge Judy Garland zu seinem 36. Geburtstag in «Broadway Melody of 1938» und schaut dabei dem lächelnden Schwerenöter auf dem Starfoto tief in die Augen. Aber das Foto ist nur eine schwache Erinnerung an den geballten Sexappeal, den Clark Gable in voller Leinwandpräsenz entfalten konnte. Sein bekanntester Film «Gone With the Wind» (1939) zeigt nicht nur Geschlechterkampf in Reinkultur, sondern ruft auch die selbstgefällige Siegerpose des unangefochtenen «leading man» einer ganzen Epoche ins Gedächtnis.
Ganz sicher kann das Lächeln der Männer, der «happy mouth» (Desmond Morris) als Seismograph für den Stand oder auch die Krisenanfälligkeit des Geschlechterverhältnisses im populären Kino angesehen werden. Das gilt vor allem für das amerikanische Kino mit seinen vorgeformten Starbildern und seinen puritanischen Empfindlichkeiten. Aber ist der Sunnyboy George Clooney nur eine Neuauflage von Clark Gable? Ohne Zweifel ist er der erste Nachfolger seit langem, der seinem Vorgänger in vieler Hinsicht das Wasser reichen kann. Clooney ist zwar kein raubeiniger Working Class Hero wie Gable, aber er ist eben auch ein richtiger Mann, der schon frühzeitig die «ewigen Jungs» aus Hollywood, Brad Pitt, Johnny Depp, Matt Damon, Ben Affleck oder Leonardo DiCaprio, ausgestochen hat. Nur Brad Pitt hat ihm einmal die begehrte Rolle in «Thelma & Louise» (1991) weggeschnappt und konnte mit seinem Waschbrettbauch Filmgeschichte schreiben. Da ist sie, die Körper-Rhetorik, die spätestens seit «American Gigolo» (1980) unbedingt zur Eintrittskarte in den Kreis der Auserwählten gehört: die gelungene Rauminszenierung des gut durchtrainierten Oberkörpers (und mehr). Clooney hat sich indes nur einmal – in der Rolle des Bankräubers, der von Sheriff Jennifer Lopez gejagt wird – so ganz in die Niederungen der Körperarbeit begeben. Noch während der Dreharbeiten von «Out of Sight» (1998) wurde er zum «Sexiest Man Alive» (Magazin People) gekürt. Der inzwischen silbergraumelierte Gentleman, der Altstar Cary Grant immer ähnlicher wird, hat etwas, was ihm keiner so schnell nachmachen kann: Intellekt, Witz und eine Portion Selbstironie.
Kinostars haben ein langes Leben. Wenn man in dem 2002 erschienenen Essayband «Göttliche Kerle» blättert – fünfzehn Jahre danach –, sind alle grossen Namen noch da. Es fehlt allenfalls das Paar Jake Gyllenhaal und Heath Ledger aus «Brokeback Mountain» (2005). Der früh verstorbene Jungstar Ledger wurde schon als neues Sexidol gehandelt; Gyllenhaal hat sich nach seinem schwulen Coming-out (auf der Leinwand) erwartungsgemäss zum Charakter- und Actionstar entwickelt. Charakter zeigt der ausgewachsene Star heute in Neo-Noir-Filmen oder bei zeitkritisch engagierten Themen. Da punktet schon wieder Clooney mit Filmen wie «Syriana» (2005) oder «Michael Clayton» (2007). Aber muss der Mann, der ins Auge geht, eigentlich Charakter haben? Die Geschichte der Stars erzählt etwas anderes.
Lächeln ist Sexappeal pur! Da lächelt nicht nur der Mund, sondern es lächeln vor allem die Augen. Da kann sich Clooney – wie seinerzeit Gable – auch noch auf seine Augenbrauen als Mitspieler verlassen. Damit endet aber auch schon der Vergleich mit dem «King». Aber der grösste Kultstar aller Zeiten, Stummfilmbeau Rudolph Valentino, war kein Lächler. Als erster Latin Lover der Filmgeschichte, als männlicher Vamp, hat er die schon damals tradierten Codes amerikanischer Maskulinität zum ersten Mal unterwandert und die Frauenherzen mit sadomasochistischen Szenarien und einem polymorphen, zwischen feminin und maskulin oszillierendem Sexappeal erobert. Als Schablone für alle zukünftigen amerikanischen Leinwandhelden muss hingegen Valentinos Zeitgenosse Douglas Fairbanks Senior in Betracht gezogen werden. Der Held mit Mantel und Degen, ein «richtiger» Mann, energiegeladen bis zum Anschlag, Inbegriff von Pioniergeist und American Dream, entblösste schon bereitwillig seinen prachtvollen Oberkörper und seine perlweissen Zähne dazu. Beide sind exemplarische Entwürfe, die im Lauf eines Filmjahrhunderts zu komplexeren Männerbildern verschmelzen. Nur das martialische Imponiergehabe der Muskelmänner und Maschinenmenschen à la Schwarzenegger verharrt auf Stereotypen und Rückschritt.
Mächtige Aussenseiterposten besetzen der schon erwähnte Cary Grant und Rock Hudson. Der britische Meister des Understatements und der «all-American boy», der «good guy» schlechthin. Der bärenstarke Hüne Rock Hudson überraschte gleich beide Geschlechter, als im Zusammenhang mit seiner Aids-Erkrankung seine Homosexualität bekannt wurde. Mit seinem umwerfenden Charme und seinen unzähligen Verwandlungen – vom naiven Naturburschen bis zum charakterlich verdorbenen, aber wandelbaren Playboy – stand er wie ein Fels in der Brandung des untergehenden Studiosystems.
Der Aufstieg des echten Charakterdarstellers und des «method acting» waren nicht aufzuhalten. Bald stand das Lächeln auf der Abschussliste, als die «angry young men» – «loner» à la Marlon Brando, James Dean, Steve McQueen – in ihren T-Shirts und Lederjacken die Leinwände stürmten, die Höflichkeit abschafften, stattdessen die Buddy-Movies und den Männlichkeitswahn in Mode brachten. Das erste Buddy-Paar Paul Newman und Robert Redford führte in «Butch Cassidy and the Sundance Kid» (1969) vor, wie Männer Hand in Hand in den Abgrund springen oder – in der Schlussapotheose – lustvoll ballernd auf die Kamera zulaufen und dabei selbst den Tod finden. Wo zu viel Testosteron im Spiel ist, kommt es leicht zu «verhängnisvollen Ejakulations-Exzessen», befindet die für «Gender-Hysterie» ausgewiesene amerikanische Filmwissenschaftlerin Cynthia J. Fuchs.
Die erbarmungslose Maskulinisierung des amerikanischen Kinos in den Siebzigerjahren, die mit dem zunehmenden Ausschluss der Frauen von der Leinwand und mit zunehmender Misogynie einherging, muss vor dem Hintergrund des Vietnamtraumas, vor allem jedoch in der Angst der Männer vor der forcierten Geschlechterpolitik der Frauenbewegung gesehen werden. In ihrem bahnbrechenden Buch «XY. Die Identität des Mannes» hat Elisabeth Badinter die Identitätskrisen des westlichen Mannes unter die Lupe genommen. Zu ihren wichtigsten Erkenntnissen gehören der männliche Orientierungsverlust angesichts überkommener Verhaltensweisen sowie die Leugnung der Bisexualität als Ursache für die zunehmende Virilität und ihre Entartungserscheinungen. Der «harte Mann» der Reagan-Ära und der entmenschlichte «Terminator», der martialische Mann also, stelle nur noch die Konstruktion eines idealen Körpers dar, der totale Kontrolle signalisiert und die Virilität als Trägerin der Macht feiert. Zu Clark Gables Zeiten schlugen starke Frauen, Leinwandpersönlichkeiten wie Jean Harlow, Jean Arthur oder Joan Crawford verbal oder mit der flachen Hand zurück. Geschlechterkampf unter Gleichen. Lang, lang ist’s her.
Körperkult oder Körper-Dilemma
Richard Gere hat es geschafft. Sein «American Gigolo» (1980) illustriert als höchst dotierter Strichjunge von Beverly Hills einen Wendepunkt im Erscheinungsbild des «leading man». Er gilt als erstes männliches Sexobjekt seit James Dean. Der hüllenlose Adonis präsentiert sich nicht nur als erotisches Ganzkörper-Objekt für den weiblichen Blick, sondern auch als verletzbarer Mann, als Versager und zuletzt als Opfer. Seinen Männerkörper, der nur für die weibliche Lust gemacht zu sein schien – eine Ausnahmeerscheinung im amerikanischen Kino –, versteckt er heute hinter der Eleganz eines Senior Statesman; am wiegenden Gang ist er sofort zu erkennen («The Dinner», 2017). Als praktizierender Buddhist, Humanist und gesuchter Ratgeber gibt sich Gere heute als seriöser Verführer. Auch andere namhafte Stars, von Leonardo DiCaprio bis Brad Pitt, punkten heute in gesellschaftlicher Mission.
Die Zeiten, als sich Gere als Nachfolger des anarchistischen Kleingangsters Jean-Paul Belmondo im amerikanischen Godard-Remake «Breathless» (1983) hervortat, sind endgültig vorbei. Aber auch Belmondo und Alain Delon sind noch da. Belmondo hatte – von der Hutkrempe bis zur typischen Handbewegung – das coole Styling von Humphrey Bogart übernommen, die Ladies waren eher Nebensache. Das erste französische Buddy-Paar Belmondo/Delon führte in «Borsalino» (1970) lässig und überzeugend vor, dass es im französischen Film so etwas wie gemeinsame Lächel- oder Badeverbote zwischen Männern einfach nicht gibt. Zwar blieben auch dem europäischen Kino weder Geschlechterkampf noch der «geschwächte» Mann erspart, aber auf dem alten Kontinent hat man es stets besser verstanden, männliche wie weibliche Eigenschaften in einem Männerkörper zu versöhnen. Das ganz andere europäische Konzept des Sexappeals gipfelt in Marcello Mastroiannis Latin Lover. Mastroianni hält mit stillvergnügtem Schmunzeln die von Meister Fellini ausgebrüteten Männerphantasien des «lächerlichen» Mannes bis zum bitteren Ende durch.
Marli Feldvoss ist Publizistin, Filmkritikerin und Dozentin für Filmgeschichte. Sie schreibt Kritiken, Porträts, Essays über Film und Literatur für Radio, Fernsehen und Printmedien, u.a. lange Jahre für die FAZ, die NZZ, die NZZ am Sonntag, DU, epd Film und Filmbulletin. 2013 ist im Stroemfeld Verlag ihre Publikation «Unterwegs im Kino. Kritiken und Essays», die Texte aus 30 Jahren versammelt, erschienen.
 Heute
Heute