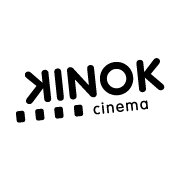Von überirdisch bis eiskalt
Blonde Musen sind im Trend
von Alexandra Stäheli
Sie hat wohl durch das gesamte 20. Jahrhundert eine noch wildere Berg- und Talfahrt hinter sich gebracht als der Aktienkurs von General Motors, mit ganz klarem Abwärtstrend gegen das Ende des Jahrtausends hin: Die Haarfarbe Blond, in der Antike einst durch die Nähe zum Strahlen des Goldes als Zeichen göttlicher Wesensart gefeiert, hat im Zeitalter der omnipräsenten Bilder (und von käuflichem Wasserstoffperoxid) vielerlei Deutungen durchlaufen – bis zur vorläufigen Bankrotterklärung in den Neunzigerjahren. Eines der letzten Hochs konnte noch Madonna verzeichnen, das «Material Girl», das sich unverhohlen als zweite Marilyn Monroe inszenierte und im Video zum Song auch Monroes ikonische Szene aus Howard Hawks’ «Gentlemen Prefer Blondes» (1953) zitierte. Danach war Stille. Und die Ära der Blondinenwitze brach an. Eine junge Mädelsband nannte sich in der Folge zu Beginn der Neunzigerjahre keck und stolz «4 Non Blondes» – und alle gendersensiblen Eltern mussten zähneknirschend anerkennen, wie kreativ sich Kinder im Vorschulalter über Blondinen lustig machen können, auch wenn sie den Inhalt der eifrig kursierenden Witze nicht wirklich verstehen.
Doch weil es das Modebusiness so sehr liebt, gerade die als besonders verschmockt geltenden Dinge wieder aus den alten Archiven hervorzukramen und mit neuer Bedeutung aufzuladen, zeigt das Trendbarometer von Frauenzeitschriften und Friseursalons seit kurzer Zeit wieder nach oben: Platinblond ist jetzt wieder angesagt. Die Haarfarbe Wasserstoffblond habe mit vielen negativen Assoziationen zu kämpfen, erklärte so kürzlich eine Modekritikerin im Internet. Seine Trägerinnen gälten als barbiehaft, unnatürlich und unnahbar. Der neue Trend möchte nun aber gar nicht gegen diese Assoziationen ankämpfen, sondern sie vielmehr für sich selbst nutzen: Das unnatürliche, beinahe ins Silbergraue fallende Blond wird nun schlicht als elfenhaft, überirdisch und «nicht von dieser Welt» gefeiert, als ein Zeichen göttlicher Entrücktheit – wie damals, als Hollywood in den Dreissigerjahren die blonden Engel und die überlebensgrossen Diven erfunden hatte.
Ja, überhaupt lässt sich wohl etwas grosszügig konstatieren, dass innerhalb der Geschichte des Films kaum ein anderes Körpermerkmal auf der Leinwand so pointiert inszeniert wurde wie die blonde Haarpracht. Der Auftritt blonder Frauen markiert fast immer eine bewusste oder unbewusste Setzung innerhalb eines Szenengefüges. Am Blondton sollst du sie erkennen: den Charakter der Figuren, den Verlauf der Story oder auch nur die Handschrift eines bestimmten Regisseurs. Wobei das Verhältnis der Geschlechter gerade in Bezug auf die Haarfarbe Blond bis heute leider praktisch unangetastet geblieben ist. Oder wann haben blonde Männer in der Filmgeschichte schon mal richtig für Furore gesorgt und sind als mit den Insignien der Kulturindustrie aufgeladene Ikonen ins kollektive Gedächtnis eingegangen?
Paul Richter mag in Fritz Langs «Nibelungen» (1924) als Siegfried mit wallender Mähne, herrischem Blick und muskulösem Körper einen drohenden Vorboten auf das nationalsozialistische Ideal des nordischen Kämpfers gegeben haben; Robert Redford hat sich – spätestens mit «Out of Africa» (1985) an der Seite einer auffallend brünetten Meryl Streep – in den Annalen des Films einen ewigen Platz als romantischer, (rot)blonder Naturbursche gesichert; und Orlando Bloom wirkt seit «Lord of the Rings» in all seinen Rollen ohne geflochtene Silberhaarperücke irgendwie unfertig und sehr gewöhnlich. Aber raubt uns dies wirklich nachts den Schlaf?
Nein, das Privileg des ostentativen und bedeutungsvollen Blondseins gehört in der Geschichte des Films seit den Anfängen und bis heute noch immer den Frauen. Dabei mag es wohl nicht zuletzt auch an den technischen Möglichkeiten der Beleuchtung im frühen Schwarz-Weiss-Film gelegen haben, dass Schauspielerinnen wie Camilla Horn (in Friedrich Wilhelm Murnaus «Faust») oder Brigitte Helm (in Fritz Langs «Metropolis») ihre Haare aufhellen lassen mussten, um sich zuweilen fast schon ätherisch-strahlend von ihrem düsteren Umfeld abheben zu können. Der scharfe Kontrast zwischen Licht und Schatten, hell und dunkel, gut und böse, den der deutsche expressionistische Film der Zwanzigerjahre so virtuos auszuspielen wusste, fand seine ungleich ambivalentere, komplexere und letztlich auch grausamere Fortsetzung im amerikanischen Film Noir, der die Bilder verkantete und die einst so klar gezeichneten Linien zwischen gut und böse, Täter und Opfer zu verwischen begann: Aus den blonden Engeln und lächelnden Marienfiguren waren nun eiskalte, teuflische Todesbotinnen geworden, skrupellose Mörderinnen, als deren schlagkräftigste Waffe sich gerne ein verwirrter Antiheld mit schwachem Herzen entpuppte.
Ein ganz eigenes Universum um blonde Protagonistinnen hat sich Alfred Hitchcock in seinen Filmen errichtet. Sein strenger Umgang mit und sein höchst ambivalentes, vergötternd-verachtendes Verhältnis zu blonden – oder zum Blondsein vertraglich gezwungenen – Schauspielerinnen ist sprichwörtlich geworden: Grace Kelly, mit der er in nur zwei Jahren drei Filme drehte, bevor sie durch ihre Heirat mit Fürst Rainier von Monaco ihre Karriere als Schauspielerin beendete, verkörperte für den Perfektionisten den Idealtypus der kühlen, innerlich aber vor Sehnsucht glühenden Schönheit, die in ihrer durchgestylten Eleganz ein Produkt der männlich dominierten Bilderindustrie ist – die sich aller Künstlichkeit zum Trotz ihren männlichen Mitspielern gegenüber letztlich aber dennoch als physisch und psychisch überlegen erweist.
In «Vertigo» (1958) mit Kim Novak in der Hauptrolle der ätherisch-eleganten Madeleine legt Hitchcock diesen gesamten Mechanismus seines eigenen, grausamen Spiels der Geschlechter bis ins letzte Detail erschreckend schonungslos offen: Der psychisch angeschlagene Ex-Detektiv Scottie (James Stewart) verfällt da gänzlich seinen eigenen Projektionen einer hyperperfekten Frau, die er partout und mit aller Macht nicht in ihrer wahren brünetten Erscheinung (und in ihrer wahren Stärke) sehen möchte – bis er mit seinem Zwang zur Idealisierung am Ende alles zerstört. Ein ganz ähnliches, aber noch nicht so pessimistisches Setting findet sich auch schon in «Rear Window» vier Jahre zuvor, in dem diesmal ein physisch lädierter, an einen Rollstuhl gefesselter Fotograf (James Stewart) mit Hilfe seiner schönen Freundin Lisa (Grace Kelly) ein Verbrechen im Hinterhof aufdeckt. Das immer perfekt gestylte Model in Petticoat und Stöckelschuhen entpuppt sich dabei als abenteuerlustige und mutige Frau, die in der Wohnung des Täters wichtige Beweisstücke sammeln und somit zur Aufklärung des Falls beitragen kann, während der unbewegliche (und man könnte ruhig auch psychoanalytisch sagen: kastrierte) Jeff seinen Beitrag zum Geschehen einzig als Voyeur am Fenster zum Hof leisten kann.
Ein ähnliches, wenn auch etwas komplizierteres System hat Woody Allen in seinen Filmen um blonde, junge Frauen herum aufgebaut. Wie auch bei Hitchcock scheinen die zarten, bleichen und hellhaarigen Mädchen zunächst so eine Art Musenfunktion im Allenschen Kreativitätstempel zu übernehmen: Schauspielerinnen wie Mia Farrow, später dann Mira Sorvino, Drew Barrymore, Cate Blanchett, Naomi Watts und Scarlett Johansson haben den Filmemacher immer wieder zu den zunächst verträumteren, mit zunehmendem Alter dann auch verbiesterteren Geschichten um die Irrwege der Liebe und um das Verhältnis von Zufall und Schicksal inspiriert, auch wenn es für die von ihnen verkörperten Figuren am Ende des Films oft nicht zum Besten steht: Als kaltblütig entsorgte Leiche – oder zumindest finanziell und psychisch ruiniert – entlassen sie uns oft mit gemischten Gefühlen ins Tagesgeschehen zurück, hatte doch zunächst alles so verheissungsvoll für die hübschen, intelligenten und erfolgreichen Blondinen ausgesehen.
«I like blondes», sagt der unglückliche Filmkritiker Allan (verkörpert von Woody Allen) in dem 1972 erschienenen Film «Play It Again, Sam». «Little blondes with long hair and short skirts and boots and big chests and bright, witty and perceptive.» Und so ganz kann man sich den Eindruck nicht verkneifen, dass aus diesen Sätzen auch Allen, der Filmemacher, spricht. Kleine, gut gebaute, intelligente, espritvolle Blonde in kurzen Röckchen, das erinnert vor allem an die späten, in Europa spielenden Filme von Woody Allen. Dabei mag es kein Zufall sein, dass sich gerade kürzlich zwei hartnäckige Langzeitbrünette für ein Filmprojekt mit dem Altmeister in Blondinen verwandelt haben: Miley Cirus (titelloses Amazon-TV-Projekt) und Kristen Stewart («Café Society») sind erbleicht. Die Arbeit mit Allen habe Spass gemacht, hatte Stewart an einer Pressekonferenz in Cannes erklärt, wo «Café Society» dieses Jahr ausser Konkurrenz gelaufen ist. Dafür habe sie sich auch nur zu gerne ihre Haare ruiniert.
Alexandra Stäheli studierte Philosophie und Germanistik, arbeitete als Redaktorin für verschiedene Zeitungen und unterrichtete an Kunsthochschulen. Seit einigen Jahren ist sie im Bereich Kunstförderung der Christoph Merian Stiftung tätig und arbeitet als freie Journalistin und Autorin in den Bereichen Film und Belletristik.
 Heute
Heute